Es war nicht so ungewohnt, wie man vermuten könnte. Mit „Hochamt für Toni“ gab es bereits einen Film, in dem Felix weitgehend alleine durch Franken streifte. Es war dennoch ein Intermezzo, das ich aufgrund der schönen Begegnung mit Sigi Zimmerschied in seiner Gastrolle als radikal wortkarger Betreuer Fred und der herausragenden atmosphärischen Dichte des Films ziemlich genießen konnte.
Ihr Kommissar ist durch eine Verletzung körperlich eingeschränkt – wie verändert diese Einschränkung den Ermittler Felix Voss und dessen Herangehensweise an den Fall?
Er ist auf fremde Hilfe angewiesen. Für jemanden wie Felix, der alleine lebt, alleine Entscheidungen trifft, der also ein sozial vermittelbarer Loner ist sozusagen, bringt der Unfall im Bad zwei Formen des Schmerzes mit sich: einen leiblichen und einen Schmerz, der aus der Kränkung entsteht, dass ihm sein Leib versagt. Vielleicht machen ihn diese seine Schmerzen aber auch wacher und empfänglicher für die Schmerzen anderer Menschen. Das ist ja oft so.
Die Figur des Fred, gespielt von Sigi Zimmerschied, bringt eine ganz neue Dynamik ins Ermittlerteam. Wie haben Sie die Zusammenarbeit empfunden – und wie verändert sie Voss?
Fred ist nicht nur ein anderer Mensch, er scheint geradezu ein anderes Wesen zu sein, zunächst. Felix wird immer wieder von diesem Fremden überrascht und eine merkwürdige Nähe entsteht gerade durch diese Andersartigkeit, die Felix vor Augen führt, dass das Leben ja auch ganz anders betrachtet und gegriffen werden kann. Und andererseits sind sie in den entscheidenden Momenten ganz zusammen. Fred und Felix demonstrieren, wie trotz aller Unwahrscheinlichkeit Gemeinschaft gelebt werden kann. Ganz abgesehen davon ist das alles sehr, sehr lustig.
Der Fall rund um den verschwundenen Fahrradhändler Andreas Schönfeld scheint zunächst wenig Angriffsfläche zu bieten. Was hat Sie an der psychologischen Tiefe des Falls besonders interessiert?
Eben diese psychologische Tiefe, die menschliche Tiefe, die moralischen Grenzen.
Im Laufe des Films rückt das Paar Lisa Blum und Stephan Gellert in den Fokus. Wie haben Sie sich auf die intensive finale Zuspitzung vorbereitet, bei der es um eine „menschlich zutiefst tragische Katastrophe“ geht?
Ich versuche immer, ganz einzutauchen in die Situation, in jede Situation. Brecht sagte einst: „die Situationen sind die Mütter der Menschen“. Das ist ein Satz, den ich immer in mir trage bei Dreharbeiten. Die jeweilige Situation lässt Dich spüren und denken und leitet Dich.
Ihre Darstellung bleibt oft minimalistisch, fast zurückgenommen – wirkt aber gerade dadurch eindringlich. Wie nähern Sie sich einer Figur wie Felix Voss emotional an?
Ich setze mich jeder Rolle vollkommen aus, zumindest versuche ich mich, vor und während der Dreharbeiten genau so einzustimmen, dass ich Denken und Fühlen verändern kann. Das ist der unschätzbare Vorzug meiner Tätigkeit als Schauspieler: ich kann mich und mein Eingeübtes verlassen, wenn nicht völlig, so doch zum Teil. Und für einen Moment, für die Zeit am Drehort, ein anderer sein, auf Zeit.
2023 waren Sie in der Satire «Browser Ballett» in der Rolle eines moderierenden Markus-Lanz-Typs zu sehen. Was reizt Sie an solchen genreübergreifenden Formaten abseits des klassischen Schauspiels?
Jeder deutsche Gymnasiast, jede deutsche Gymnasiastin musste oder durfte in Hesses „Steppenwolf“ lesen: „der Mensch ist ein Sternenhimmel“. Und so gehe ich an meine Tätigkeiten heran. Ich habe nie eine „Karriere“ geplant. Dieses Wort kommt mir nie in den Mund, denn es leitet sich etymologisch ab von „Rennbahn“. Ich sehe mich aber auf keiner Rennbahn, mein Leben ist kein Weg zum Erfolg. Ich glaube an Begegnungen, die auch dadurch entstehen, weil andere Menschen Anderes in mir sehen, als ich es tue, wenn ich in den Spiegel schaue. Ich langweile mich nie und zwar genau deswegen: ich laufe auf keiner Bahn, sondern nehme gerne Umwege, lande bereitwillig in Sackgassen und nehme es in Kauf, auch mal umdrehen zu müssen. Ich war gerade einmal wieder in Paris mit meiner geliebten Frau. Wir hatten zwar an den jeweiligen Tagen immer auch ein grobes Ziel. Aber wir liefen auch einfach so herum, ließen uns von unseren Augen und Sinnen leiten. Das ist ja auch „Denken“: sinnliche Entscheidungen treffen. Und siehe da: wir fanden meist die wunderbarsten Orte und Restaurants und Cafés, die wir niemals durch einen zielgerichteten „Marsch durch Paris“ gefunden hätten. Niemals. Durchs Leben tanzen, nicht durchs Leben marschieren. Und so mache ich das auch mit den Angeboten: ich biege einfach mal ab.
Sie sind sowohl Mitglied der Deutschen als auch der Europäischen Filmakademie. Was möchten Sie dort als Künstler und politischer Mensch einbringen – was sehen Sie als Ihren Auftrag?
Dass Zweckmäßiges ohne Zweck, was Kunst mehr oder minder ja ausmacht, inmitten aller industriellen Anforderungen nicht unmöglich ist. Und dass Deutschland, dieser schlafende filmästhetische Riese, endlich mal aus dem mehrjährigen Schlaf erwacht. Dazu müsste Herr Weimer aber das ermöglichen, was alle seine Vorgängerinnen nicht schafften oder schaffen wollten: dass juristische Personen, dass Unternehmen Steuervorteile erhalten, wenn sie in Filme investieren. Das würde die Filmindustrie und in ihrem Fahrwasser die Filmkunst der Verwaltung und ihrem Denken entreißen, zumindest hin und wieder.
Der «Tatort: Ich sehe dich» lebt stark von Stimmungen, Brüchen und Zwischenräumen. Wie wichtig ist für Sie das, was nicht gesagt oder gezeigt wird – im Spiel wie im Leben?
Atmosphären bestimmen unser Leben. Materialien, Materialitäten, Stimmungen, Nichtsprachliches, das wir spüren, für das wir aber keine Worte haben. Diese wieder als Mächte wahrzunehmen und anzuerkennen, hilft uns, endlich diese behauptete Spaltung zwischen Denken und Fühlen zu überwinden, die es im Menschen selbst nicht gibt. Es gibt keinen Gedanken ohne Gefühl, es gibt kein Gefühl, ohne zu denken. Atmosphären und Sinnlichkeit grundsätzlich werden hier in Deutschland diskriminiert als Mägde und Diener der Vernunft. Aber das sind sie nicht und ein Leben, dass davon nichts weiß und spürt, ist nur ein nacktes Leben.
Danke für Ihre Zeit!
Das Erste zeigt den neuen «Tatort» am Sonntag, den 14. September, um 20.15 Uhr.


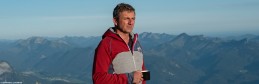





 Stefan Raab kommt öfters
Stefan Raab kommt öfters Netflix zeigt Historien-Action «Néro the Assassin»
Netflix zeigt Historien-Action «Néro the Assassin» 








 Mediengestalter Bild & Ton / 2nd Broadcast Operator (m/w/d)
Mediengestalter Bild & Ton / 2nd Broadcast Operator (m/w/d) Redaktionsleitung (m/w/d) im Bereich Factual Entertainment / Reality am Standort Ismaning bei München oder Köln in befristeter Anstellung
Redaktionsleitung (m/w/d) im Bereich Factual Entertainment / Reality am Standort Ismaning bei München oder Köln in befristeter Anstellung Initiativbewerbungen (m/w/d)
Initiativbewerbungen (m/w/d)




Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel