Seit Beginn der Streaming-Ära hat sich die Bewegtbildnutzung stark verändert. Nachdem Streaming über Jahre hinweg kontinuierlich auf Kosten des linearen Fernsehens gewachsen ist, haben sich die Anteile inzwischen eingependelt: In den vergangenen drei Jahren blieb das Verhältnis zwischen linearer und Streaming-Nutzung weitgehend stabil. Die größten Unterschiede zeigen sich zwischen den Altersgruppen. Bei den 18- bis 24-Jährigen liegt der Streaming-Anteil bei über 80 Prozent, während er bei den 55- bis 69-Jährigen lediglich rund 48 Prozent beträgt. TV bleibt damit als Reichweiten- und Branding-Kanal weiterhin eine feste Größe.
Die intensive Streaming-Nutzung, insbesondere in jungen Zielgruppen, verdeutlicht, wie sehr sie die Flexibilität und Kontrolle darüber schätzen, welchen Content sie wann konsumieren. Für BVOD- und FAST-Anbieter bleibt ein starkes On-Demand-Angebot daher eine zentrale Zukunftsinvestition.
Ob die „Streaming Natives“, die mit Netflix und Co. aufgewachsen sind, ihre Gewohnheiten dauerhaft beibehalten oder – je nach Lebenssituation – wieder stärker ins lineare Fernsehen „reinwachsen“ und etwa am Feierabend mit der Familie einfach das laufende TV-Programm einschalten, bleibt abzuwarten.
Besonders auffällig ist die steigende Akzeptanz für Werbung in kostenlosen Angeboten. Wie erklären Sie sich diesen deutlichen Anstieg seit 2023?
Das hängt mit wirtschaftlichen Faktoren zusammen, aber auch damit, dass die Streaming-Services in den letzten Jahren ihre Monetarisierungsmodelle verändert haben: Hybrid-Modelle wurden eingeführt und werbefreie Abos sind deutlich teurer geworden. Kostenbewusste Kunden weichen deshalb zunehmend auf hybride oder gar kostenlose Angebote aus. Immer mehr Nutzende haben dabei verstanden, dass sich kostenloser Content nicht von selbst finanziert. Werbung ist die Gegenleistung dafür.
Die Studie zeigt deutlich die positive Haltung zu Werbung innerhalb von Gratis-Content: Nur 8 Prozent lehnen Werbung in kostenlosen Streaming-Umgebungen strikt ab. Bei kostenpflichtigen Diensten hingegen akzeptieren 54 % nicht einmal einen einzelnen Spot. Werbung im Bezahlumfeld sorgt sogar oft für Verärgerung, was 68 % der Befragten angeben.
Ein wichtiger Punkt ist das sogenannte Abo-Hopping. Welche Herausforderungen bringt dieses flexible Nutzerverhalten für Werbungtreibende mit sich?
Klassisches Fernsehen, Paid-Streaming und kostenlose Angebote konkurrieren um die Aufmerksamkeit der User. Nutzende sind im Schnitt auf mindestens fünf Plattformen unterwegs (linear plus durchschnittlich vier Apps) und wechseln zudem regelmäßig zwischen diesen Apps. Nicht wenige User betreiben zudem Abo-Hopping: 77 Prozent kündigen aus Kostengründen und 40 Prozent, weil Wunschinhalte fertig geschaut wurden.
Marken stehen vor der Herausforderung, ihre Zielgruppen nicht mehr über eine einzige Plattform abbilden zu können. Theoretisch müssten sie über eine Vielzahl von Plattformen hinweg werben, um ihre Zielgruppe im TV-Umfeld vollständig zu erreichen. Viele denken bei TV noch an ein einziges Gerät und wünschen sich den „einen Kanal“, über den alle erreicht werden können. Tatsächlich ist ein Smart-TV heute jedoch eher mit PC oder Smartphone vergleichbar. Auch dort gibt es keine „One-fits-all“-Strategie, sondern fragmentierte Touchpoints – ob In-App, über Displaywerbung oder andere Formate.
Hinzu kommt für Marken das Problem der Messbarkeit von Kampagnen. Hier hat TV immerhin einen klaren Vorteil: Automatic Content Recognition (ACR)-Technologien erlauben es, plattformübergreifend auf Geräteebene zu messen.
ACR soll helfen, Werbung relevanter und weniger repetitiv auszuspielen. Wie weit ist die Branche hier schon – und wo liegen die Grenzen?
Automatic Content Recognition erkennt, welche Inhalte und Spots bereits gezeigt wurden, und ermöglicht so gezieltes Targeting noch nicht erreichter Geräte. Technisch ist ACR sehr weit. Die größte Herausforderung bleibt der Datenschutz. Datenverknüpfungen sind nur mit expliziter Zustimmung zulässig. Das ist für uns zentral.
Die Platzierung auf dem Startbildschirm von Smart TVs gilt als Gold wert. Welche Strategien empfehlen Sie Marken, um dort sichtbar zu bleiben?
Die Fülle an Inhalten und Services führt zu Entscheidungsmüdigkeit bei den Nutzenden. Laut Studie fühlen sich 14 Prozent von der Programmauswahl überfordert, 22 Prozent kehren während des Fernsehens ins Startmenü zurück, 10 Prozent brechen die Suche ganz ab. Im Schnitt dauert es fünf Minuten, bis Content gefunden ist.
Der Homescreen gewinnt deshalb als Navigationshilfe an Bedeutung: 74 Prozent starten ihre TV-Nutzung mittlerweile direkt dort und nicht im laufenden Programm. Eine prominente Platzierung auf dem Homescreen ermöglicht es Marken, Nutzende frühzeitig abzuholen – sei es über eine Masthead-Platzierung, eine Streaming-Empfehlung, eine Verlinkung zur eigenen App oder zum YouTube-Kanal.
Viele Nutzer fordern ein „faires Werbeerlebnis“. Was verstehen Sie konkret darunter, und welche Erfolgsbeispiele gibt es bereits?
Es geht letztlich um Werbeakzeptanz. Eine Art Deal: Gratis-Content gegen Werbung. Solange die Länge von Inhalten und Werbepausen in einem ausgewogenen Verhältnis steht, empfinden das die Nutzenden als fair. Ein Paradebeispiel dafür ist FAST („Free Ad-Supported Streaming“): Dieses Format hat sich als Gegenmodell zu den teils recht teuren Streaming-Services etabliert und wird seit seiner Einführung von immer mehr Werbetreibenden in die ganzheitliche TV-Strategie integriert. Sie profitieren dabei von der höheren Werbeakzeptanz im Gratis-Umfeld. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass die Werbeblöcke in FAST-Formaten meist deutlich kürzer als im linearen TV sind, was die Zustimmung der Nutzenden weiter erhöht.
Connected TV (CTV) gilt als Zukunftsfeld. Worin unterscheiden sich die Möglichkeiten dort von klassischer TV-Werbung?
Der größte Unterschied ist die Präzision im Targeting. Im CTV können Zielgruppen anhand von Interessen, Sehgewohnheiten, geografischen Daten oder demografischen Merkmalen angesprochen werden. Ergänzend lassen sich Third-Party-Daten, etwa Kaufabsichten, sowie First-Party-Daten aktivieren.
Gerade in Kombination mit klassischer TV-Werbung ist CTV-Werbung unschlagbar: Wir können inkrementelle Reichweiten liefern, indem wir Geräte von Usern, die einen Spot bereits im linearen TV gesehen haben, gezielt ausschließen und in einer CTV-Kampagne nur jene ansprechen, die linear nicht erreicht wurden.
Second-Screen-Nutzung ist Alltag: 61 Prozent der Zuschauer haben parallel ihr Smartphone in der Hand. Welche Chancen ergeben sich daraus für interaktive Werbung, etwa mit QR-Codes?
91 Prozent der Second-Screen-Nutzenden schreiben Nachrichten, 48 Prozent shoppen online. Das eröffnet Werbetreibenden spannende Möglichkeiten. QR-Codes sind dafür ein gutes Beispiel: Sie schlagen die Brücke zwischen dem Lean-Back-Medium TV und einem aktiven Nutzererlebnis. 51 Prozent der Befragten interagieren, wenn das Produkt für sie relevant ist und scannen dann auch. So wird aus einem Werbekontakt schnell eine Conversion.
Datennutzung ist ein sensibles Thema. Wie lassen sich Smartphone-Daten sinnvoll in die Kampagnenplanung integrieren, ohne die Akzeptanz der Nutzer zu gefährden?
Wir sind mittlerweile in Europa in der Lage, anonymisierte Daten von 70 Millionen Smart-TVs mit 20 Millionen Samsung-Smartphones zu verknüpfen. Aber ausschließlich mit aktiver Zustimmung der User, Datenschutz hat für uns höchste Priorität.
Da wir so viel mit unserem Handy machen, sind diese Daten fürs Targeting enorm wertvoll und können die Relevanz von CTV-Kampagnen stark verbessern: etwa Finanzprodukte für Investment-App-User oder die neuesten Elektroautos für Lade-App-Nutzende.
Zum Abschluss: Wenn Sie einen Ausblick wagen – wie wird sich die Smart-TV-Nutzung in den nächsten fünf Jahren verändern, und welche Rolle wird Werbung darin spielen?
Spannende Dinge werden auf dem Homescreen passieren. Er wird in Zukunft noch personalisierter, interaktiver und smarter – unterstützt durch KI, kontextuelle Daten und Voice-Interfaces. Besonders jüngere Zielgruppen erwarten intelligente Features. Für Marken bedeutet das mehr kreative Spielräume, mehr relevante Touchpoints und eine tiefere Integration in den Alltag der Nutzenden. Dabei bleibt die User Experience entscheidend. Deshalb legen wir großen Wert auf klare Schutzkriterien für Werbung. Davon profitieren am Ende alle: Nutzende ebenso wie Werbetreibende.
Vielen Dank für Ihre Zeit!


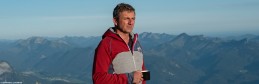





 Programm-Marken: «Hundertdreizehn» kommt über 1 Millionen aber nicht an «Sommerhaus» vorbei
Programm-Marken: «Hundertdreizehn» kommt über 1 Millionen aber nicht an «Sommerhaus» vorbei  Europa grillt ab November den Henssler
Europa grillt ab November den Henssler 








 Mediengestalter Bild & Ton / 2nd Broadcast Operator (m/w/d)
Mediengestalter Bild & Ton / 2nd Broadcast Operator (m/w/d) Redaktionsleitung (m/w/d) im Bereich Factual Entertainment / Reality am Standort Ismaning bei München oder Köln in befristeter Anstellung
Redaktionsleitung (m/w/d) im Bereich Factual Entertainment / Reality am Standort Ismaning bei München oder Köln in befristeter Anstellung Initiativbewerbungen (m/w/d)
Initiativbewerbungen (m/w/d)




Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel