Ich erinnere mich sehr gut an unser erstes Treffen, als ich ihn um die Erlaubnis bat, ihn bei seiner ersten Opernproduktion zu filmen. Ich war sehr nervös, denn für mich war dieser Dokumentarfilm enorm wichtig. Ich stellte mich vor und versuchte, so ehrlich wie möglich zu sein. Ich wollte, dass er versteht, dass ich diesen Film wirklich machen wollte und vollkommen in seine Philosophie und seine Art, Kunst einzusetzen, eingebunden war. Außerdem erzählte ich ihm von mir selbst und von der Geschichte meiner Familie. Ich bin halb Russe, halb Italiener, und mein Vater musste 1982 wegen der kommunistischen Diktatur aus Russland fliehen. Ich wuchs also in einer Familie auf, in der Meinungsfreiheit immer eine zentrale Rolle spielte – und ich wusste, dass dieses Thema auch für ihn wichtig ist. Während ich sprach, blieb er sehr still und hörte nur zu. Am Ende fragte ich: „Darf ich Sie bitte bei Ihrer Arbeit filmen?“ Er sah mich an und sagte einfach Ja. Das war alles – so einfach. Während des Opernprozesses habe ich verstanden: Wenn er Ja sagt, ist es ein Ja, aber wenn er Nein sagt, dann ist es ein Nein – ohne Diskussion. Ich werde ihm für dieses Ja immer dankbar sein.
Warum haben Sie «Turandot» als Ihr Spielfilmdebüt gewählt – lag es an der Oper selbst, Ai Weiwei oder an der Kombination beider?
Ich wollte schon immer einen Dokumentarfilm darüber drehen, „warum wir Kunst brauchen“. Warum der Mensch seit jeher den Drang verspürt, sich auf diese Weise auszudrücken und zu kommunizieren. Also schrieb ich die Struktur des Films schon zwei Jahre vor meinem ersten Treffen mit Ai Weiwei. Mit der Produktionsfirma Incipit Film und Produzentin Marta Zaccaron lernte ich den erfahrenen Autor Michele Cogo kennen. Zusammen sahen wir uns die kommende Spielzeit der Oper Rom an – und entdeckten, dass Ai Weiwei Puccinis «Turandot» inszenieren würde. Wir wussten sofort: Das ist die perfekte Produktion, um unsere zentrale Botschaft zu transportieren – und für mich ein Versuch, eine Antwort auf meine Frage zu finden: Warum brauchen wir Kunst? Wir waren überzeugt, dass Ai Weiweis «Turandot» weit mehr sein würde als eine „klassische“ Oper, dass sie durch seine Vision die Welt außerhalb ins Theater hineintragen würde.
Ai Weiwei ist dafür bekannt, Kunst und Politik als untrennbar miteinander verbunden zu sehen. Wie haben Sie diesen Gedanken filmisch eingefangen, ohne dass Ihr Film zu einem rein politischen Porträt wird?
Eine gute Frage, ich musste darüber nachdenken. Ich glaube, der Film ist nicht nur ein politisches Porträt, weil ich etwas anderes erzählen wollte. Ich suchte nicht nach dem Politischen, sondern wollte verstehen, warum Ai Weiwei Kunst braucht, warum er sie macht. Welchen Platz Kunst in unserer heutigen Welt hat. Warum Menschen ins Theater gehen. Während ich also versuchte, meinen Film zu machen und Antworten zu finden, stießen meine Fragen mit Ai Weiweis Wesen zusammen – und sein Wesen ist eben auch politisch. So konnte ich über ihn meine eigenen Antworten formulieren.
Natürlich wurde das alles noch einmal viel kraftvoller, als während der Produktion wegen Covid-19 plötzlich alles stillstand. Künstler weltweit verloren auf einen Schlag ihre Bühne. Jeder musste sich fragen: „Warum mache ich das alles?“ Auch Ai Weiwei sagt im Film: „Kunst war immer wie ein Zuhause für mich – und plötzlich bricht es ein.“ Wenn man etwas verliert, das man für selbstverständlich hielt, begreift man erst seinen Wert. Als wir es zurückgewannen, wussten alle, was es bedeutet. In diesem Moment haben die Künstler, hat die Kunst, ihren Platz in unserer Welt noch klarer erkannt.
In der Produktion gibt es Bezüge zum Krieg in der Ukraine und zur Flüchtlingskrise. Wie haben Sie entschieden, diese politischen Dimensionen im Film sichtbar zu machen?
Das ergab sich ganz natürlich. Die Dirigentin Oksana Lyniv und die Sängerin Oksana Dyka, die Prinzessin Turandot spielte, kamen beide aus der Ukraine. Als der Krieg ausbrach, war die Anspannung im ganzen Theater spürbar. Es gab sogar einen Moment, in dem über eine erneute Unterbrechung der Aufführung nachgedacht wurde. Diese Spannung war unmöglich auszublenden – also musste sie Teil des Films sein.
Sie begleiten nicht nur Ai Weiwei, sondern auch zentrale Figuren wie Dirigentin Oksana Lyniv und Tenor Michael Fabiano. Welche Rolle spielten diese Stimmen für die Dramaturgie Ihres Films?
In einer Opernproduktion sind Regisseur und Dirigent die Schlüsselfiguren. Um Oper zu verstehen, muss man sowohl die Dramaturgie als auch die Musik kennen. Über die Dirigenten Alejo Pérez (2020) und Oksana Lyniv (2022) wird Puccinis Vision begreifbar, der Plot von «Turandot». Michael Fabiano, der die Rolle des Calaf singt, zusammen mit Ai Weiweis langjähriger Freundin, der Choreographin Ching Chiang, fungiert gewissermaßen als Brücke zwischen Puccinis und Ai Weiweis Turandot. Am Ende gibt Ai Weiwei seine eigene Interpretation. Ich würde sagen: Jeder im Film ist ein Bote zwischen der klassischen Puccini-Oper Turandot und der neuen Sichtweise Ai Weiweis.
Im Film trifft Ai Weiwei wieder auf die Choreografin Chiang Ching, die ihn einst als jungen Mann in der «Turandot»-Inszenierung an der Met besetzt hatte. Welche Bedeutung hatte diese Begegnung?
Ich würde es nicht als Wiedersehen bezeichnen, denn sie standen immer in Kontakt. Sie sind enge Freunde. Aber Ching Chiang ist eine zentrale Figur für meinen Film. Sie ist die Einzige, die sowohl intim als auch künstlerisch über Ai Weiwei sprechen kann. Sie kannte seine Eltern und half ihm während seines Studiums in New York. Durch sie konnte ich Ai Weiweis Welt noch tiefer entdecken – nicht nur aus künstlerischer, sondern auch aus menschlicher Sicht.
Dokumentationen über große Künstler schwanken oft zwischen Bewunderung und kritischer Distanz. Wie haben Sie Ihre Haltung zu Ai Weiwei gefunden?
Ich war schon immer ein Fan seiner Arbeit, also wollte ich keinen kritischen Film drehen. Mich interessierte, warum er Kunst braucht und wie er sie nutzt. Besonders spannend war für mich, ihn bei etwas völlig Neuem zu beobachten, außerhalb seiner Komfortzone. Theater und Oper folgen strengen Regeln: Musik, Libretto, hunderte Beteiligte auf und hinter der Bühne – ganz anders als bei seiner bisherigen Arbeit, bei der er die Regeln selbst festlegte. Ihn hier zu begleiten, noch dazu in schwierigen Zeiten wie Covid und Krieg, war für mich wie das Entstehen einer neuen Art von Ai Weiwei-Kunst zu erleben. Bei seinen Installationen wäre er in seinem Element gewesen – geschützt durch Wissen und Erfahrung. Bei «Turandot» war er verletzlicher, weil er eine neue Sprache und eine komplexe Maschinerie verstehen musste. Genau das wollte ich zeigen.
Ai Weiweis «Turandot» gilt als multisensorisches Erlebnis. Welche filmischen Mittel haben Sie eingesetzt, um diese Ästhetik einzufangen?
Vielen Dank für das Kompliment. Zunächst wollte ich das Team so klein wie möglich halten – nur drei Leute: ich, ein zweiter Kameramann und ein Tonmann. So konnten wir im Theater nahezu unsichtbar arbeiten, und die Menschen verhielten sich natürlicher. Ich legte außerdem großen Wert auf den Ton, besonders auf die Musik. In diesem Film ist die Musik selbst eine Figur: Puccinis Stimme. Ich wollte sie so mischen, dass das Publikum seine Präsenz spürt. Dazu kommen vier Super-Slow-Motion-Sequenzen: Die Figuren bewegen sich langsam, als Verkörperungen großer Werte wie Liebe, Freiheit oder Tyrannei. Solche Dinge bewegen sich langsam, weil sie Gewicht haben. In diesen Szenen sieht man keine Bühnenränder, sondern Close-ups und Details, die im Theater verborgen bleiben. Für mich macht das den Film wirklich immersiv.
Puccinis Oper ist über 100 Jahre alt. Wie sehen Sie Ihre heutige Relevanz – und was haben Sie persönlich dabei über die Bedeutung klassischer Oper im 21. Jahrhundert gelernt?
Die Werte in «Turandot» – Liebe, Freiheit – werden immer relevant sein. Sie können romantisch, politisch oder anders gedeutet werden. Auch in 100 Jahren werden diese Fragen neue Antworten finden, die Ihre jeweilige Gegenwart widerspiegeln. Dass Puccini die Oper nicht vollendete, lag nicht nur an seinem Tod, sondern auch daran, dass er keine Antwort auf diese großen Fragen fand. Er überließ es künftigen Generationen, sie weiterzuführen.
Der Film zeigt auch viele Backstage-Momente. Welche Proben-Szenen haben Sie am meisten bewegt?
Definitiv der Moment, als das gesamte Theater wegen Covid geschlossen wurde. Man sieht es den Gesichtern an: Fassungslosigkeit, Dunkelheit, sogar die Gefühle standen still. Auch für mich war es schwer – plötzlich war alles weg. Ich hatte zwei Optionen: Entweder Covid zerstört alles, oder es liefert die Antwort auf meine Frage „Warum brauchen wir Kunst?“. Kunst wurde ausgelöscht – Theater, Museen, Konzerte. Aber haben wir sie wirklich verloren? Während des Lockdowns überlebten wir mental dank Filmen, Musik, Büchern, Malerei. Da wurde mir klar: Wir brauchen Kunst genauso wie Nahrung. Als das «Turandot»-Team 2022 zurückkehrte, war alles anders – Bühne, Atmosphäre, auch mein Filmen. Wer etwas so Wichtiges verliert und zurückbekommt, hält es umso fester.
Es war Ihr Filmdebüt. Welche besonderen Herausforderungen brachte das Projekt mit sich – und was nehmen Sie für die Zukunft mit?
Die größte Schwierigkeit war die lange Zeitspanne: Von den ersten Ideen 2018 bis zur Fertigstellung 2025 – sieben Jahre. In dieser Zeit verändert sich alles: Welt, Menschen, Partner. Doch der Film musste stilistisch und inhaltlich konsistent bleiben, damit das Publikum in 77 Minuten eine kohärente Geschichte erlebt. Für die Zukunft hoffe ich, immer dieser Kohärenz treu zu bleiben – und Themen zu finden, die so stark sind, dass sie auch in einem veränderten Umfeld unverändert gültig bleiben.
Ihr Film startet nun auch in deutschen Kinos. Was wünschen Sie sich, dass das Publikum nach 77 Minuten mitnimmt?
Ich hoffe, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer (oder: das Publikum versteht) verstehen, dass Kunst nicht nur in Museen existiert, sondern in jedem von uns – als Werkzeug, um Botschaften auszudrücken, welcher Art auch immer. Kunst ist zutiefst menschlich, und wir brauchen sie, um zu kommunizieren und zu leben.
«Ai WeiWeis Turandot» ist ab 16. Oktober in deutschen Kinos zu sehen.








 «Der Schrei» kommt in die ARD Audiothek
«Der Schrei» kommt in die ARD Audiothek Aylin Tezel: ‚Die schottischen Highlands haben eine unerklärliche Mystik‘
Aylin Tezel: ‚Die schottischen Highlands haben eine unerklärliche Mystik‘
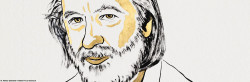







 Ausbildung Kauffrau/ Kaufmann (w/m/d) für audiovisuelle Medien
Ausbildung Kauffrau/ Kaufmann (w/m/d) für audiovisuelle Medien Praktikant im Bereich Redaktion in unserem Format "Shopping Queen" (m/w/d)
Praktikant im Bereich Redaktion in unserem Format "Shopping Queen" (m/w/d) Mediengestalter Bild & Ton / 2nd Broadcast Operator (m/w/d)
Mediengestalter Bild & Ton / 2nd Broadcast Operator (m/w/d)




Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel