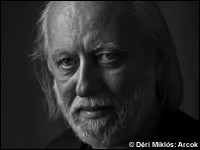 Mit László Krasznahorkai ehrt die Schwedische Akademie in diesem Jahr einen Schriftsteller, der sich dem schnellen Lesen konsequent verweigert. Der 1954 im ungarischen Gyula geborene Autor ist ein Meister der Langsamkeit, der Intensität, des gedanklichen Strudels. Seine Sätze winden sich über Seiten, seine Bücher sind schwer, düster, fast apokalyptisch. Für viele ist Krasznahorkai der letzte große Metaphysiker der europäischen Literatur – einer, der die Welt nicht beschreibt, sondern seziert.
Mit László Krasznahorkai ehrt die Schwedische Akademie in diesem Jahr einen Schriftsteller, der sich dem schnellen Lesen konsequent verweigert. Der 1954 im ungarischen Gyula geborene Autor ist ein Meister der Langsamkeit, der Intensität, des gedanklichen Strudels. Seine Sätze winden sich über Seiten, seine Bücher sind schwer, düster, fast apokalyptisch. Für viele ist Krasznahorkai der letzte große Metaphysiker der europäischen Literatur – einer, der die Welt nicht beschreibt, sondern seziert.Bekannt wurde er in den achtziger Jahren, in einer Zeit, in der Ungarn noch unter der erstarrten Spätphase des Kommunismus stand. Schon sein Debüt „Sátántangó“ (1985), in Deutschland unter dem Titel „Satanstango“ erschienen, war eine Zumutung im besten Sinne. In einer verfallenden Dorfgemeinschaft entfaltet sich ein Albtraum von Schuld, Hoffnung und Verlorenheit. Das Buch besteht aus Sätzen, die sich winden, kreisen, schrauben – wie Gedanken, die keinen Ausweg finden. Spätestens mit der monumentalen Verfilmung durch Béla Tarr, die 1994 mit einer Laufzeit von über sieben Stunden Filmgeschichte schrieb, wurde Krasznahorkai zu einem Kultautor.
Viele seiner Werke sind eng mit Tarrs Filmen verbunden. Die beiden schufen gemeinsam «Verdammnis» (1988), «Die Werckmeisterschen Harmonien» (2000), «The Man from London» (2007) und «Das Turiner Pferd» (2011) – Filme, in denen die Zeit gedehnt wird, bis sie fast stillsteht. Die Dunkelheit, die Leere, die metaphysische Starre – all das ist nicht nur filmisches Motiv, sondern das Herz seiner Literatur. Krasznahorkai interessiert sich nicht für Handlung, sondern für Zustand. Seine Romane sind Zustandsbeschreibungen der Erschöpfung.
„Die Melancholie des Widerstands“ (1989) machte ihn auch im Westen bekannt. Ein Zirkus zieht in eine trostlose Stadt, ein toter Wal wird zur Metapher für den Verfall der Ordnung. Es ist ein Roman über das Ende – aber auch über den verzweifelten Wunsch nach Struktur. In „Krieg und Krieg“ (1999) reist ein Archivar nach New York, um ein geheimnisvolles Manuskript zu veröffentlichen, das ihn in den Wahnsinn treibt. Wieder geht es um den Kampf zwischen dem Chaos und der Sehnsucht nach Sinn.
Mit „Seiobo auf Erden“ (2008) und später „Baron Wenckheims Rückkehr“ (2016) verfeinerte Krasznahorkai seine Methode. Er schreibt wie ein Komponist, der jeden Ton in der Dunkelheit platziert. In „Seiobo auf Erden“ begegnen Menschen der Schönheit – in japanischen Tempeln, in venezianischen Museen, in der Kunst selbst. Es ist eines seiner zugänglichsten Bücher, ein Versuch, das Göttliche in der Welt zu entdecken. Dafür erhielt er 2015 den Man Booker International Prize. Seine jüngeren Werke wie „Herscht 07769“ (2021) oder „Im Wahn der Anderen“ (2023) führen seine Erzählweise fort – sprachlich exzessiv, aber nie selbstverliebt. Sie zeigen, dass Krasznahorkai nicht nur Chronist des Untergangs ist, sondern auch ein Autor, der Schönheit in der Verzweiflung findet.







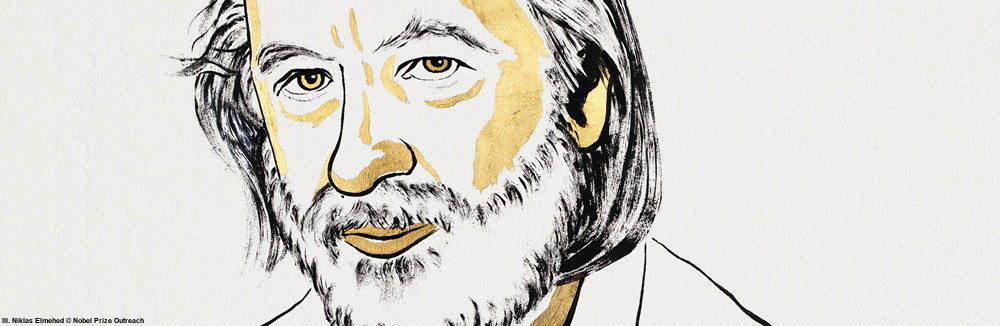


 «Rote Rosen»: Neue Zweifel und alte Konflikte
«Rote Rosen»: Neue Zweifel und alte Konflikte ProSiebenSat.1 erweitert Aufsichtsrat um zwei neue Mitglieder
ProSiebenSat.1 erweitert Aufsichtsrat um zwei neue Mitglieder








 Senior Manager Campaign Management & Social Media (m/w/d)
Senior Manager Campaign Management & Social Media (m/w/d) 1. Aufnahmeleitung im Bereich Reality (m/w/d)
1. Aufnahmeleitung im Bereich Reality (m/w/d) Studentische Aushilfe (m/w/d) ? YouTube-/Twitch-Team
Studentische Aushilfe (m/w/d) ? YouTube-/Twitch-Team




Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel