 Für zahlreiche Wissenschaftler wird der globale Süden in den wichtigsten Medien zu kurz dargstellt. Quotenmeter fragte deshalb bei ARD Aktuell, beim ZDF und bei RTL/ntv an, wie unterschiedlich auf die Ereignisse reagieren. Während RTL/ntv offen einräumt, auf tagesaktuelle Einordnung ohne eigene Reihen zu setzen, verweisen ARD und ZDF auf konkrete Formate und Doku-Serien. Entscheidend ist am Ende nicht die schiere Anzahl von Beiträgen, sondern die Platzierung, die Formathöhe und die Frage, ob Inhalte über den Nachrichtenfluss hinaus im Gedächtnis bleiben.
Für zahlreiche Wissenschaftler wird der globale Süden in den wichtigsten Medien zu kurz dargstellt. Quotenmeter fragte deshalb bei ARD Aktuell, beim ZDF und bei RTL/ntv an, wie unterschiedlich auf die Ereignisse reagieren. Während RTL/ntv offen einräumt, auf tagesaktuelle Einordnung ohne eigene Reihen zu setzen, verweisen ARD und ZDF auf konkrete Formate und Doku-Serien. Entscheidend ist am Ende nicht die schiere Anzahl von Beiträgen, sondern die Platzierung, die Formathöhe und die Frage, ob Inhalte über den Nachrichtenfluss hinaus im Gedächtnis bleiben.RTL/ntv betont, Themen aus dem Globalen Süden sehr ernst zu nehmen. Auch wenn sie sich im Alltag schwer durchsetzen lassen, greife man sie regelmäßig in den Nachrichten auf, wenn Chancen, Risiken oder Entwicklungen sichtbar würden, die auch für die deutsche Gesellschaft relevant seien. Eigene Reihen oder feste Sendungen gebe es jedoch nicht. Der Schwerpunkt liege auf verständlicher Einordnung und unmittelbarem Bezug zur Lebensrealität des Publikums. Das ist ein ehrlicher Ansatz: RTL/ntv beansprucht nicht, ein Doku- oder Reportagemotor für den Globalen Süden zu sein, sondern arbeitet stark eventgetrieben und innerhalb eines Relevanzkorridors. Journalistisch sind diese Themen nicht marginal, aber sie bleiben formatökonomisch nachrangig. Tagesnachrichten sind kurz, konkurrieren hart um Sendezeit und verschwinden schnell im News-Strom. Ohne wiedererkennbare Label-Flächen fehlt ein Auffindbarkeitsanker in Mediathek oder Streaming-Angeboten. Die Inhalte sind zwar da, sie bleiben aber flüchtig.
 Die ARD stellt die Dinge anders dar. Die Redaktion von ARD-aktuell verweist auf Produktionshürden, betont aber, der Globale Süden sei nicht abgehängt. Als konkretes Beispiel wird eine «Tagesthemen»-Reihe mit sechs zusätzlichen Reportagen aus dem Berichtsgebiet des Studios Nairobi genannt. Diese Platzierung in den «Tagesthemen» ist durchaus hochwertig: Ein später Abend, ein Leitformat, in dem seltenere Regionen als Reportage und nicht nur als Agenturstück auftauchen. Das ist kein Randthema, sondern redaktionelles Premium, wenn auch zeitlich limitiert und damit nicht dauerhaft verankert. Auch der «Weltspiegel» spielt eine tragende Rolle. Seit Jahrzehnten gilt er als erste Adresse für Auslandsstoff im Ersten, und jüngst zeigte die Ausgabe vom 14. September 2025 mit dem Beitrag „China/Afrika: Ein Deal fürs Leben?“ genau jenen Blick auf strukturelle Beziehungen, der im Alltag der Nachrichten fehlt. Das ist relevant und nicht randständig. Aber: Der Beitrag läuft nicht in der 20.00 Uhr-«Tagesschau» und wird deshalb auch von vielen Menschen nicht wahrgenommen.
Die ARD stellt die Dinge anders dar. Die Redaktion von ARD-aktuell verweist auf Produktionshürden, betont aber, der Globale Süden sei nicht abgehängt. Als konkretes Beispiel wird eine «Tagesthemen»-Reihe mit sechs zusätzlichen Reportagen aus dem Berichtsgebiet des Studios Nairobi genannt. Diese Platzierung in den «Tagesthemen» ist durchaus hochwertig: Ein später Abend, ein Leitformat, in dem seltenere Regionen als Reportage und nicht nur als Agenturstück auftauchen. Das ist kein Randthema, sondern redaktionelles Premium, wenn auch zeitlich limitiert und damit nicht dauerhaft verankert. Auch der «Weltspiegel» spielt eine tragende Rolle. Seit Jahrzehnten gilt er als erste Adresse für Auslandsstoff im Ersten, und jüngst zeigte die Ausgabe vom 14. September 2025 mit dem Beitrag „China/Afrika: Ein Deal fürs Leben?“ genau jenen Blick auf strukturelle Beziehungen, der im Alltag der Nachrichten fehlt. Das ist relevant und nicht randständig. Aber: Der Beitrag läuft nicht in der 20.00 Uhr-«Tagesschau» und wird deshalb auch von vielen Menschen nicht wahrgenommen. Neben solchen Hochflächen verweist die ARD auf eine Vielzahl von Online-Beiträgen, von Meldungen über Diphtherie in Somalia bis zu Hintergrundstücken über den Austritt von Mali, Burkina Faso und Niger aus der ECOWAS. Auch im Kongo, im Sudan oder in der Elfenbeinküste entstanden Reportagen, die Themen jenseits akuter Kriegsereignisse aufgreifen, etwa über Goldminenarbeit oder Klimafolgen für Kakaoplantagen. Hinzu kommen gesellschaftliche Hoffnungsgeschichten wie Biodiversitätsprojekte in Kenia oder innovative Landwirtschaft in Somalia. Diese Vielfalt ist bemerkenswert, sie bleibt jedoch fragmentiert. Die Stoffe verteilen sich über «Tagesschau», «Tagesthemen», «Weltspiegel», Landesrundfunkanstalten, Mediathek und Social-Media-Kanäle. Das erschwert Auffindbarkeit und Wiedererkennbarkeit. Zwar sind die inhaltlichen Zugänge breit und reichen bis hin zu fiktionalen Projekten wie dem Film «Verschollen» mit begleitender Dokumentation, aber es fehlt die dauerhaft gebrandete Klammer, die dem Publikum signalisiert: Hier geht es kontinuierlich um den Globalen Süden.
 Das ZDF wiederum verweist auf sein weltweites Netz von 18 Auslandsstudios, darunter Kairo, Nairobi, Johannesburg und Rio de Janeiro. Ein zentrales Anliegen sei es, die Lebensrealitäten der Menschen sichtbar zu machen. Als prominentes Beispiel nennt die Redaktion die Reihe «Megacitys», die zuletzt Episoden über Mumbai, Lagos und Rio de Janeiro zeigte. Hier handelt es sich nicht um Randprogramm, sondern um eine klar erkennbare Doku-Marke, die sowohl im linearen Fernsehen als auch in der Mediathek präsent ist. Die Erzählweise ist zugänglich, die Perspektive der Städte bei Nacht verleiht den Filmen eine klare Dramaturgie, und die Themen kontextualisieren urbane Herausforderungen, soziale Spaltung oder kulturelle Dynamiken. Damit schließt die Reihe jene Lücke, die entsteht, wenn in Nachrichten vor allem Krisen behandelt werden.
Das ZDF wiederum verweist auf sein weltweites Netz von 18 Auslandsstudios, darunter Kairo, Nairobi, Johannesburg und Rio de Janeiro. Ein zentrales Anliegen sei es, die Lebensrealitäten der Menschen sichtbar zu machen. Als prominentes Beispiel nennt die Redaktion die Reihe «Megacitys», die zuletzt Episoden über Mumbai, Lagos und Rio de Janeiro zeigte. Hier handelt es sich nicht um Randprogramm, sondern um eine klar erkennbare Doku-Marke, die sowohl im linearen Fernsehen als auch in der Mediathek präsent ist. Die Erzählweise ist zugänglich, die Perspektive der Städte bei Nacht verleiht den Filmen eine klare Dramaturgie, und die Themen kontextualisieren urbane Herausforderungen, soziale Spaltung oder kulturelle Dynamiken. Damit schließt die Reihe jene Lücke, die entsteht, wenn in Nachrichten vor allem Krisen behandelt werden.Flankiert wird diese Reihe durch das «auslandsjournal» am Mittwochabend und digitale Formate wie «Global PolitiX». Zusammengenommen ergibt das eine Angebotsfamilie, die wiederkehrend sichtbar ist, sowohl im linearen Programm als auch on-demand. Die Stärke des ZDF liegt in dieser Markenbildung. Wer den Globale-Süden-Schwerpunkt sucht, findet ihn leichter, weil es wiederkehrende Reihen gibt, die sich über Jahre hinweg einprägen.
Vergleicht man die drei Häuser, zeigen sich klare Unterschiede. RTL/ntv liefert tagesaktuelle Beiträge, setzt aber keine Schubfläche für Nachhaltigkeit. Die ARD verfügt über starke Leitflächen wie «Tagesthemen» und «Weltspiegel» und über eine breite Ausspielung auf digitalen Kanälen, bleibt aber zersplittert und damit in der Wahrnehmung weniger gebündelt. Das ZDF hat mit «Megacitys» eine prägende Marke etabliert, die sichtbar, anschlussfähig und international relevant ist.
Wer behauptet, der Globale Süden fände gar nicht statt, greift also zu kurz. Er findet statt – die entscheidende Frage ist jedoch, wo und wie. Reihen und Leitflächen prägen Erinnerung und Haltung weit stärker als verstreute Einzeltakes. Genau dort, in der formatierten Kontinuität, entscheidet sich, ob Afrika, Lateinamerika oder Südasien im deutschen Fernsehen eine dauerhafte Präsenz entwickeln oder weiterhin nur episodisch auftauchen.










 ‚Für mich ist es keine Festlegung, sondern spannend, Ivo weiterzuentwickeln‘
‚Für mich ist es keine Festlegung, sondern spannend, Ivo weiterzuentwickeln‘ 3 Quotengeheimnisse: ZDF on tour
3 Quotengeheimnisse: ZDF on tour


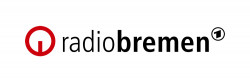





 Senior Manager Campaign Management & Social Media (m/w/d)
Senior Manager Campaign Management & Social Media (m/w/d) 1. Aufnahmeleitung im Bereich Reality (m/w/d)
1. Aufnahmeleitung im Bereich Reality (m/w/d) Studentische Aushilfe (m/w/d) ? YouTube-/Twitch-Team
Studentische Aushilfe (m/w/d) ? YouTube-/Twitch-Team




Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel