Ästhetik der Möglichkeiten
 Ein zentrales Versprechen von On-Demand-Angeboten besteht in der Möglichkeit, sich Videos selbstständig auszuwählen oder auszulassen, sie in eine beliebige Reihenfolge zu ordnen oder mehrfach anzusehen. Einzig den eigenen Vorlieben folgend, lässt sich in den Interfaces von einem zum anderen Video springen und durch die reichhaltigen Datenbanken surfen. Zuweilen stundenlang, wenn man sich – und wer kennt diese Situation mittlerweile noch nicht – endlos von Video zu Video klickt und sich in der Angebotsfülle schier verliert. Auch gänzlich ohne technische Automatisierung kann hierbei eine Art Sog entstehen, der derart einladend und zugleich mitreißend ist, dass es sich als eine Herausforderung für die eigene Willenskraft gestaltet, sich ihm zu entziehen.
Ein zentrales Versprechen von On-Demand-Angeboten besteht in der Möglichkeit, sich Videos selbstständig auszuwählen oder auszulassen, sie in eine beliebige Reihenfolge zu ordnen oder mehrfach anzusehen. Einzig den eigenen Vorlieben folgend, lässt sich in den Interfaces von einem zum anderen Video springen und durch die reichhaltigen Datenbanken surfen. Zuweilen stundenlang, wenn man sich – und wer kennt diese Situation mittlerweile noch nicht – endlos von Video zu Video klickt und sich in der Angebotsfülle schier verliert. Auch gänzlich ohne technische Automatisierung kann hierbei eine Art Sog entstehen, der derart einladend und zugleich mitreißend ist, dass es sich als eine Herausforderung für die eigene Willenskraft gestaltet, sich ihm zu entziehen.Diese Erfahrung, sich vom Programm gefangen zu fühlen, hat Raymond Williams bereits im Jahr 1974 für das damalige Fernsehen beschrieben:
Weiterhin ist es eine häufige, wenn auch reumütig zugegebene Erfahrung, dass es viele von uns schwierig finden, den Fernseher auszuschalten; und dass wir uns wieder und wieder, auch wenn wir für eine bestimmte ‚Sendung‘ angeschaltet haben, dabei erwischen, wie wir die Sendung danach angucken und die darauf folgende ebenfalls. Dies wird sicherlich durch die Art, in der der flow inzwischen organisiert ist, nämlich ohne eindeutige Einschnitte, verstärkt. Wir können uns schon ‚in‘ etwas Neuem befinden, bevor wir die Energie gesammelt haben, uns aus dem Stuhl zu erheben […].
Offenbar wirken in Plattformen wie Netflix und YouTube vergleichbare Mechanismen wie beim William’schen (Fernseh-)Flow. Dies aber wäre dann ein Flow, der sich (bei deaktiviertem Autoplay) gerade nicht automatisiert ergibt oder gar von einer äußeren Instanz vorgegeben wird, denn die Filme und Videos müssen selbst ausgewählt und manuell gestartet werden. Er basiert auf einem fortwährenden Auswahl- und Interaktionsprozess, der von der nutzenden Person so lange aufrechtgehalten wird, wie sie jeweils motiviert ist, noch immer einen weiteren Beitrag anzuklicken. Für YouTube hat William Uricchio diese Beobachtung daher gekennzeichnet als den Wandel von einem Flow nach Vorgaben zu einem Flow, der als Bedingung für seinen Fortlauf eine aktive Auswahl verlangt („a shift from flow as default to flow as a condition that requires active selection“ ).
Wie aber entsteht dieser flow-artige Drang, immer noch ein Video anklicken zu wollen, im dem sich eine Facette der Fernsehhaftigkeit von Online-Plattformen wie Netflix und YouTube ausdrückt? Offenbar gelingt es den Diensten, stets genau die richtigen Videos anzubieten, um die nötige Motivation zum Weitergucken aufrechterhalten zu können. Eine Ursache muss demnach in den weiteren Empfehlungen gesucht werden, die als Ergänzung zu jedem angeklickten Video zusätzlich vorgeschlagen werden. Das Interface von YouTube stellt diese in Form einer Liste rechts neben der Abspielfläche des angeklickten Videos zur Verfügung. Zusätzlich erscheint im Fall der Deaktivierung der Autoplay-Funktion am Ende jedes Videos eine weitere Auswahl von zwölf Videos, die im Videofenster als ein Mosaik (als eine Fläche) angeordnet werden. Wie Frank Kessler und Tobias Mirko Schäfer festhalten, führte jede Wahl eines YouTube-Videos zu einer Einladung oder Empfehlung, immer noch mehr zu schauen („to an invitation, or proposition, to watch more“ ). Eine vergleichbare Einladung erhalten die Kund*innen von Netflix, wenn sie einen Titel aus dem Katalog des Dienstes aufrufen und dann mindestens zehn weitere Filme oder Serien vorgeschlagen bekommen, die vom System als „passend“ zur aktuellen Auswahl eingestuft werden.
Beide Systeme erschlagen ihre Nutzenden geradezu mit Videoempfehlungen und visualisieren damit den nahezu unerschöpflichen Umfang ihrer Bibliotheken und das daraus resultierende immense Kontingent an aggregierten Wahlmöglichkeiten. Hier ist eine Ästhetik der Möglichkeiten zu erkennen, die sich als Fläche und damit dem Prinzip des Bitmappings folgend in einer räumlichen Anordnung zeigt und die Nutzenden dazu verleiten soll, dran zu bleiben.
Die Flankierung eines ausgewählten Titels mit weiteren zum Abruf bereitstehenden Videos führt im Umkehrschluss zu der Situation, dass die getroffene Entscheidung vom Interface permanent hinterfragt wird. Die unzähligen aggregierten Vorschläge fordern dazu heraus, die getroffene Wahl mit dem anbei offerierten Angebot zu vergleichen und abzuwägen, ob nicht ein anderes Video noch größere Unterhaltung verspricht. Drum prüfe, wer sich ewig (an ein Video) bindet, ob sich nicht ein besseres findet.
Unter allen Videos herrschen eine ständige Rivalität und ein ewiger Zustand des drohenden Verdrängtwerdens. So wenig, wie das Fernsehprogramm es aushält, in der Gegenwart zu verharren und deswegen ständig mit Verweisen auf verlockende künftige Segmente versucht, sein Publikum interessiert und inaktiv zu halten, so sehr versuchen die Interfaces von Netflix und YouTube mit ihren verlockenden Aussichten auf andere Angebote, jede einmal getroffene Entscheidung zu revidieren und ihre Nutzenden aktiv zu halten. Während also der Flow des Lean-Back- oder Push-Mediums Fernsehen versucht, ein Umschalten zu verhindern, so sehr beabsichtigt der Vorschlags-Flow der Pull-Angebote Netflix und YouTube ein Klicken herbeizuführen.
Mit ihrer jeweiligen Absicht, ein Interesse für andere Segmente außerhalb des aktuell-laufenden Programms zu erzeugen, offenbart sich eine strukturelle Ähnlichkeit zwischen den Videovorschlägen der Streaming-Interfaces auf der einen Seite und den Trailern des Fernsehprogramms auf der anderen Seite. Wie groß sie ist, belegt eine Beschreibung der Fernsehtrailer von Klaas Klaassen aus dem Jahr 1997:
Die Verweisfunktion des Trailers ist kompatibel zur Hypertextstruktur des Internets, wenn der Trailer von der Zeitstruktur des Programms in die Oberflächen-(Screen-) Struktur des Bildschirms bzw. Betriebssystems wechselt. Das Ziel des Trailers, die Motivation des Zuschauers, ist dann erreicht, wenn der Zuschauer dem Link des Trailers zur Langfassung folgt, sei es mit einem Mausklick oder per Fernbedienung.
Rein funktional entsprechen die Vorschaubilder von Netflix und YouTube solchen Programmankündigungen, werden allerdings in Form von Listen aus mehreren nebeneinander dargestellten Vorschlägen und deshalb in einer räumlichen Anordnung angeboten. Der TV-Trailer ist hingegen in den linearen Programmablauf integriert und Bestandteil einer zeitlichen Ordnung. Er ist ein Abschnitt eines Nacheinanders, bei dem kuratiertes Programm und Trailer nicht parallel, sondern zeitlich hintereinander in Erscheinung treten.
Wo Netflix und YouTube offensichtlich den das Fernsehprogramm maßgeblich bestimmenden Mechanismus des Flows adaptieren und in ihren Interfaces implementieren, ahmt das Fernsehprogramm wiederum deren Benutzeroberflächen nach, indem es ästhetische Stilmittel entwickelt, die ebenfalls räumliche Parallelitäten als Ergänzung zur zeitlich-linearen Abfolge zulassen. Zu erkennen ist dieses Bemühen im Einsatz von Split-Screens etwa im informationsreichen Bild von Nachrichtensendern, im Übergang zwischen zwei Sendungen oder vor und nach Werbeunterbrechungen. Zugleich werden im laufenden Flow vermehrt Einblendungen vorgenommen, in denen Ankündigungen wie ein zusätzlicher Layer über das Programm-Interface gelegt werden. Ähnlich wie die Benutzeroberfläche von YouTube gewährleisten sie ein räumliches Nebeneinander von Programm und Programmhinweis.
Wird eine Fernsehsendung als langweilig empfunden, liefert ein schneller Wechsel des Kanals zu einem potenziell besseren Programm die sofortige Erlösung. Je nach Sichtweise kann das Zappen als unaufhörliche Flucht vor der Langweile oder als ewige Suche nach der immer noch besseren Sendung charakterisiert werden. Stellt sich hingegen ein angeklickter YouTube-Clip als uninteressant heraus, stehen sofort zahlreiche Alternativen zur Verfügung, ihn zu ersetzen. In der Möglichkeit, ungewünschte Programme zu vermeiden, sehen die Autoren Pelle Snickars und Patrick Vonderau daher zwischen dem Umherspringen zwischen verschiedenen Videos bei YouTube eine Nähe zum klassischen Zapping zwischen TV-Kanälen.
Mehr vom Gleichen
Aber, anders als beim Schalten zwischen Fernsehkanälen, wo die parallel laufenden Flows lediglich durch ihre zeitgleiche Übertragungszeit miteinander verkoppelt sind und sich die Palette der Auswahlmöglichkeiten eher zufällig zusammensetzt, besteht bei YouTube eine durch die Programmierung hergestellte semantische Verbindung zwischen den vom System bereitgestellten Vorschlägen. Diese schlägt sich vor allem in einer thematischen, inhaltlichen, personellen oder konzeptuellen Nähe zwischen den Beiträgen nieder und drückt sich auch darin aus, dass in früheren Versionen der Benutzeroberfläche über den Vorschlagslisten noch die Überschrift „Ähnliche Videos“ prangte. In der YouTube-Hilfe ist zu dieser semantischen Kausalität folgendes zu lesen:
Die nächsten Videos werden neben oder unter dem Video angezeigt, das sich ein Nutzer gerade ansieht. Sie werden basierend auf verschiedenen Faktoren automatisch ausgewählt, beispielsweise anhand des Videos, das gerade wiedergegeben wird.
Nach den bisherigen Erkenntnissen ist diese Aussage ebenso auf die Vorschlagslisten von Netflix übertragbar – insbesondere deswegen, weil sie mit den Worten „Passend zu…“ überschrieben werden. Folglich werden die Vorschläge in der Weise ausgewählt, dass sie einen (angenommenen) geschmacklichen Anknüpfungspunkt an das gewählte Video bedienen. Die Auswahl folgt einer „Mehr-vom-Gleichen“-Logik, die davon ausgeht, dass die Menschen – in ihrer Mediennutzung eher Kontinuität als Abwechslung – eher Verlässlichkeit als Überraschung – anstreben. Ihnen wird anstelle einer breiten Palette aus möglichst unterschiedlichen Angeboten eine homogene Auswahl angereicht, die allenfalls feine Schattierungen umfasst und dadurch ein nahtloses, harmonisches Fließen zwischen den Elementen sicherstellen soll. Es entsteht ein aggregierter Fluss, der vornehmlich durch die Vermeidung von Zäsuren erzeugt wird.
Die komplexen Prozesse der Gestaltung eines TV-Programms erläutert der ehemalige Geschäftsführer des Fernsehsenders Sat.1, Roger Schawinski, in seinem Buch „Die TV-Falle“, in dem er seine Erlebnisse als Programmverantwortlicher anhand konkreter Beispiele schildert. Demzufolge wären seine planerischen Aktivitäten vor allem auf das Ziel gerichtet gewesen, die Zuschauenden möglichst lange mit dem eigenen Angebot zu begeistern und ein Umschalten auf einen konkurrierenden Sender zu verhindern. Dazu war insbesondere sicherzustellen, dass die Zuschauenden nach dem Ende eines Segments nicht um- oder abschalten, sondern in das nächste überführt werden.
Der Zuschauerfluss von einer Sendung zur nächsten – der Audience-Flow – ist ein zentraler Aspekt jeder Programmierung. […] Die wichtigste Regel ist, dass der Audience-Flow höher ist, wenn es keinen Genrewechsel zwischen den Sendungen gibt. Auf diese Weise erhalten auch schwächere Serien im Anschluss an Top-Produkte tolle Quoten. […] Ein Genrewechsel bringt hingegen generell schwächere Audience-Flows.
Unterstützung erfährt diese Behauptung durch eine Aussage, die Jan Körbelin, der ehemalige Programmdirektor des Fernsehsenders ProSieben, im Oktober 1997 auf einer Veranstaltung der Adolf Grimme Akademie äußert. Er stellt fest:
Der Zuschauer mag keine Brüche oder harten Schnitte in der Programmfarbe, er bevorzugt ‚weiche‘ Übergänge und subtile Wendungen.
In der Planung des Fernsehprogramms findet damit eine Mehr-vom-Gleichen-Logik breite Anwendung, wie jene, die in den programmierten Prozessen der Interfaces von Netflix und YouTube eingeschrieben ist. In dieser Logik bilden Fernsehprogramme und die Online-Umgebungen eine gewichtige und prägende Schnittmenge. Während die angenommene Homogenität auf den Plattformen jedoch von Algorithmen automatisiert und individualisiert errechnet wird, ist sie im Fernsehprogramm das Produkt eines komplexen Kurationsprozesses, der auf menschlichen Entscheidungen der Programmplaner*innen basiert. Wie sich dieses Verfahren im Fernsehen konkret gestaltet, verdeutlicht ein im Jahr 1992 veröffentlichtes Interview mit Marc Conrad, der wiederum der ehemalige Programmdirektor des Senders RTL war:
Wir versuchen bei RTL gerade, an allen Tagen einen homogenen Programmfluss herzustellen. Beispiel Montag: Wir beginnen um 20.15 Uhr mit «Columbo». Danach kam bislang die deutsche Version von «Top Cops», also «Auf Leben und Tod» mit Olaf Kracht. «Columbo» hatte zuletzt immer 6,5 Millionen bis 7 Millionen Zuschauer und danach kam Kracht mit 3 Millionen bis 3,5 Millionen, was sehr gut war. Aber: Gegenüber «Columbo» haben wir immer rund 3 Millionen Zuschauer verloren, weil «Top Cops» für die nicht mehr interessant genug war. In unserem Archiv hatten wir, fertig synchronisiert, noch Folgen von «Quincy» liegen. Es waren zwar viele im Haus hier dagegen, als wir gesagt haben […] montags nehmen wir nach «Columbo» dann «Quincy» ins Programm. Die US-Serie stammt von den gleichen Autoren und den gleichen Produzenten wie «Columbo». Wir haben es versucht und gleich beim ersten Mal erzielte «Quincy» auf Anhieb fast 4,5 Millionen Zuschauer. Also haben wir zwischen «Columbo» und «Quincy» nur 2 Millionen Zuschauer verloren, wo wir zuvor immer zwischen 3 Millionen und 4 Millionen verloren hatten. […] Dadurch, dass wir an diesem Tag eben diesen homogenen Programmfluss geschaffen haben, haben wir jetzt mit dem Bruchteil der Kosten, die uns vorher entstanden, viel höhere Reichweiten.
Im beschriebenen Optimierungsprozess bildet vor allem die Einschaltquote die Grundlage, der die entscheidende und einzig maßgebliche Bedeutung zugesprochen wird. Einzig auf Basis dieser Messdaten – besser auf Basis der Verhältnisse der Messwerte zueinander – wird der Programmablauf solange variiert, bis kaum noch Schwankungen in den Relationen auftreten. Die Einschaltquoten stellen für die Programmplanung somit ein vergleichbares Instrument dar, wie die Meta-Daten und Nutzungsdaten für die Algorithmen der On-Demand-Plattformen.
Mit einer solchen Vergleichbarkeit von Einschaltquoten des Fernsehens und den Nutzungsdaten von Netflix hat sich die Medienwissenschaftlerin Sarah Arnold in ihrem Aufsatz „Netflix and the Myth of Choice / Participation / Autonomy“ befasst und erkennt neben zahlreichen Gemeinsamkeiten in der Weise, wie die jeweiligen Daten generiert werden, eine entscheidende und folgenreiche Differenz. Während demzufolge die Ermittlung der Einschaltquoten des Fernsehprogramms mithilfe von Messgeräten („peoplemeter“) lediglich von einer ausgewählten Gruppe tatsächlich gemessen und nach Abschluss der Sendung für das gesamte Publikum hochgerechnet würden, überwachten und personifizierten die Algorithmen von Netflix das Nutzungsverhalten aller User*¬innen. Abseits des größeren Umfangs des Datenmaterials liege die entscheidende Abweichung darin, dass bei der Ermittlung der Einschaltquoten aus soziokulturellen Parametern – hier sind Faktoren wie Alter, Geschlecht, Wohnort, Einkommen oder Schulbildung zu nennen – im Voraus Zielgruppen gebildet und deren Verhalten ermittelt wird. Bei Netflix hingegen würden solche Identitäten erst aus dem registrierten Verhalten der Nutzenden – und damit im Nachhinein und (zunächst) unabhängig von soziokulturellen Merkmalen – entstehen. Anstelle einer Homogenität, die aufgrund gemeinsamer soziokultureller Eigenschaften angenommen wird, entsteht diese nun mithilfe von Algorithmen auf der Basis eines vergleichbaren Verhaltens. Dies aber sei ein Verfahren, welches ebenso Tücken in sich trägt, wie die panel-basierte Ermittlung der Einschaltquoten. Wie Sarah Arnold in ihrem Aufsatz nachweist, produziere das System im Zusammenspiel mit den hinterlegten Meta-Daten algorithmische Identitäten („algorithmic identity“), die durch statistische Stereotypen geprägt sein und sich aus Abgrenzungen zum Prototyp des weißen Mannes ableiten würden.
Wo für das Fernsehprogramm im Nachhinein errechnet wird, was gesehen wurde und daraus Rückschlüsse für die Kuration künftiger Programmabläufe abgeleitet werden, versuchen Streaming-Anordnungen, das Nutzungsverhalten ihrer User*innen vorauszusagen und gleichen ihre aggregierten Prophezeiungen stetig mit dem tatsächlichen Verhalten ab. Mögen diese Mechanismen zwar in voneinander abweichenden Formen ablaufen, finden sie in ihren jeweiligen Zielsetzungen eine beachtenswerte Nähe zueinander. Schließlich streben Angebote wie YouTube und Netflix, ähnlich wie das Fernsehprogramm, die Gestaltung von möglichst nahtlosen und irritationsfreien Übergängen zwischen disparaten Segmenten an, um eventuelle Impulse, das jeweilige Interface verlassen zu wollen, unterdrücken zu können. Mit dem Vorhaben, jedem Nutzenden eine Wahl aus dem umfangreichen Angebot bereitzustellen, die möglichst ideal an die eigenen Bedürfnisse und Vorlieben angepasst ist, soll ein „maßgeschneiderter“ Flow entstehen, der bereitwillig angenommen wird. Ein Flow, von dem man sich widerspruchslos treiben lässt. Je wirkungsvoller dies realisiert wird, desto stärker verschwinden allerdings ausgerechnet jene Eigenschaften aus der Wahrnehmung, mit denen sich die Online-Plattformen einst gegen das Fernsehen in Stellung gebracht haben. Die Effekte der identifizierten Algorithmen münden letztlich in der Auflösung des einstigen digitalizitären Versprechens nach nicht vorgegebenen Abläufen und eigenen Steuerungsermächtigungen. Das Ziel einer fortwährenden Optimierung des Flows geht mit einer Verwandlung des eigenen Angebots in einen Zustand einher, der sich kaum besser beschreiben lässt, als mit dem Wort FERNSEHEN.
Um ihre ästhetischen und strukturellen Ähnlichkeiten zum Fernsehprogramm aufzudecken, analysiert Christian Richter ausführlich mediale Inszenierungen von Netflix und YouTube. Die Schlagworte »Flow«, »Serialität«, »Liveness« und »Adressierung« dienen dabei als zentrale Orientierungshilfen. Antworten liefern etablierte Fernsehtheorien ebenso wie facettenreiche und triviale Beispiele. Diese reichen vom ZDF-Fernsehgarten und alten Horrorfilmen über den SuperBowl und einsame Bahnfahrten durch Norwegen bis zu BibisBeautyPalace und House of Cards. Am Ende schält sich ein Zustand von FERNSEHEN heraus, der als eine neue Version aufgefasst werden kann.
„FERNSEHEN – NETFLIX – YOUTUBE. Zur Fernsehhaftigkeit von On-Demand-Angeboten“ von Christian Richter.
Das komplett Buch ist erschienen bei Transcript und Amazon erhältlich.
Quellen:
| Williams, Raymond: Programmstruktur als Sequenz oder flow. In: Adel-mann, Ralf et. al. (Hrsg.): Grundlagentexte zur Fernsehwissenschaft. Theorie – Geschichte – Analyse. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft (2001), S. 41.
| Uricchio, William: The Future of a Medium Once Known as Television. In: Snickars, Pelle / Vonderau, Patrick (Hrsg.): The YouTube Reader. Stock-holm: National Library of Sweden (2009), S. 33.
| Kessler, Frank / Schäfer, Mirko Tobias: Navigating YouTube: Constituting a Hybrid Information Management System. In: Snickars, Pelle / Von-derau, Patrick (Hrsg.): The YouTube Reader. Stockholm: National Library of Sweden (2009), S. 280.
| Klaassen, Klaas: Morgen, „Gleich, Jetzt...“ – Trailer als Zugpferde für das Programm. In: Hickethier, Knut / Bleicher, Joan Kristin (Hrsg.): Trailer, Teaser, Appetizer. Zu Ästhetik und Design der Programmverbindungen im Fernsehen. Hamburg: LIT Verlag (1997), S. 238.
| Snickars, Pelle / Vonderau, Patrick: Introduction. In: Snickars, Pelle / Vonderau, Patrick (Hrsg.): The YouTube Reader. Stockholm: National Library of Sweden (2009), S. 15.
| Kessler, Frank / Schäfer, Mirko Tobias: Navigating YouTube: Constituting a Hybrid Information Management System. In: Snickars, Pelle / Vonderau, Patrick (Hrsg.): The YouTube Reader. Stockholm: National Library of Sweden (2009), S. 280.
| Aus dem Hilfe-Bereich von YouTube.com. Unter: https://support.google.com/ youtube/answer/92651?hl=de [aufgerufen am 27. Januar 2020].
| Schawinski, Roger: Die TV-Falle. Vom Sendungsbewusstsein zum Fernsehgeschäft. Zürich: Kein & Aber (2007), S. 140f.
| Körbelin, Jan: Das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. In: Paukens, Hans / Schümchen, Andreas (Hrsg.): Programmplanung – Konzepte und Strategien der Programmierung im deutschen Fernsehen. München: Verlag Reinhard Fischer (1999), S. 20.
| Leder, Dietrich / Anschlag, Dieter: Prophetie ist keine Kunst. Interview mit RTL-Programmdirektor Marc Conrad. In: Funkkorrespondenz, 1992, Nr. 48.
| Arnold, Sarah: Netflix and the Myth of Choice / Participation / Autonomy. In: McDonald, Kevin / Smith-Rowsey, Daniel (Hrsg.): The Netflix Effect: Technology and Entertainment in the 21st Century. London: Bloomsbury Publishing (2016), S. 49 - 62.
| Lotz, Amanda: Portals: A Treatise on Internet-Distributed Television. Ann Arbor: Michigan Publishing, University of Michigan Library (2017). Zitiert wird aus der OpenAccess-Version ohne Seitenzahlen. Unter: https://quod.lib.umich.edu/m/maize/mpub9699689/ [aufgerufen am 21. September 2018]. Abschnitt: Introduction / What Is Internet-Distributed Television?







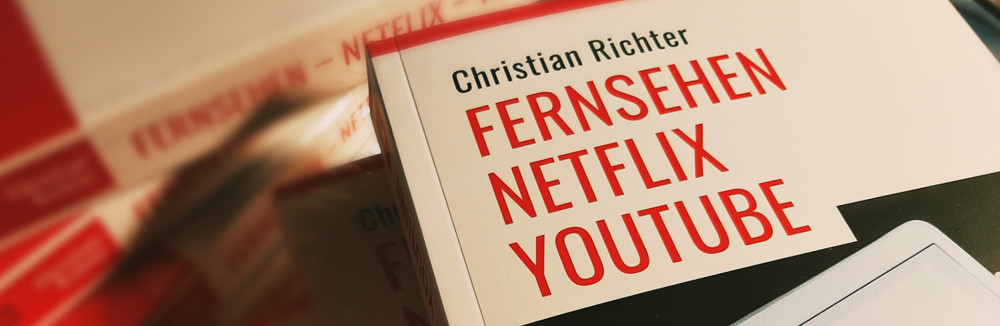


 «Mein dunkles Geheimnis» in der Zielgruppe auf Berg- und Talfahrt
«Mein dunkles Geheimnis» in der Zielgruppe auf Berg- und Talfahrt Primetime-Check: Samstag, 20. März 2021
Primetime-Check: Samstag, 20. März 2021









 Mediengestalter Bild & Ton / 2nd Broadcast Operator (m/w/d)
Mediengestalter Bild & Ton / 2nd Broadcast Operator (m/w/d) Redaktionsleitung (m/w/d) im Bereich Factual Entertainment / Reality am Standort Ismaning bei München oder Köln in befristeter Anstellung
Redaktionsleitung (m/w/d) im Bereich Factual Entertainment / Reality am Standort Ismaning bei München oder Köln in befristeter Anstellung




Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel