Stab
REGIE und DREHBUCH: Ben FalconePRODUZENTEN: Melissa cCarthy, Marc Platt, Adam Siegel, Ben Falcone
MUSIK: Fil Eisler
KAMERA: Barry Peterson
SCHNITT: Tia Nolan
DESIGN: Bill Brzeski
DARSTELLER: Melissa McCarthy, Octavia Spencer, Jason Bateman, Bobby Cannavale, Pom Klementieff, Melissa Leo, Taylor Mosby, Marcella Lowery, Ben Falcone, Kevin Dunn, Vivian Falcone, Tai Leshaun
Nun leben Parodien, wie eingangs erwähnt, in der Regel von der Frage, wie ernst sie das Genre nehmen, in dem sie sich bewegen. An diesem Punkt der Geschichte sei «Spy» als ein Positiv-Beispiel genannt, das 2015 auf den Punkt genau das Genre, in dem sich die Story bewegt, auf der Leinwand humoristisch abgebildet hat. «Spy – Susan Cooper Undercover», um den vollständigen deutschen Titel zu verwenden, ist ein James Bond-Film, der von der Suche nach verschwundenen, tragbaren Atombomben erzählt. Eine Suche, die sich in Kreisen abspielt, in denen ein James Bond für gewöhnlich agiert. Kreisen voller schöner, skrupelloser Menschen, die in ebenso schönen Umgebungen agieren, die Stil besitzen und natürlich Verbrechen planen, die weit über den Sphären dessen schweben, die gewöhnlicherweise die Welt des Verbrechens antreiben. Da müssen es eben – wie im Fall von «Spy» – tragbare Atombomben sein, die es wiederzubeschaffen gilt. Schon die Besetzung des Spielfilmes ist brillant, agiert da doch zunächst Jude Law als Agent. Jude Law als Bond? Eine absolut logische Besetzung. Erst durch seinen vermeintlichen Tod gerät die Wiederbeschaffungsaktion ins Wanken und nun hat die CIA ein Problem: Die einzige Person, die zu 100 Prozent mit seiner Mission vertraut war und den Bösen vollkommen unbekannt ist, ist seine Analystin, die normalerweise an ihrem Computer in Langley sitzt und via Satellitenüberwachung und Funk mit ihm in Verbindung stand: Susan Cooper alias Melissa McCarthy. Jene Susan Cooper, die nun nach Europa geschickt wird, um seine Mission zu beenden.
 «Spy» ist laut, aber auf eine betörende Art auch charmant. Die gesamte Handlung entspricht 1:1 einem Bond-Film der Brosnan-Ära. Tricktechnisch ist das alles A-Kino. Und die Besetzung ist perfekt. Jason Statham etwa gibt einen von seiner eigenen (nicht wirklich vorhandenen) Genialität besoffenen Superagenten – der es aber, wenn es um Action geht, es ordentlich krachen lässt; die Australierin Rose Byrne brilliert derweil als ebenso schöne wie finstere Weltenzerstörerin. Der Film steht somit auf einem soliden Grundgerüst, das nun mit Humor angereichert wird. Einem Humor, der durch eine Hauptfigur in die Story eingebracht wird, die nun auch keine Amateurin ist. Sie ist eine blitzgescheite Analystin. Was sie halt nicht ist: Eine Agentin im Außeneinsatz. Was dann zu einigen wirklich krachend komischen Situationen durch die Brechungen des zu Erwartenden führt, da Susan halt immer wieder – auf ihre Art und Weise – improvisieren muss.
«Spy» ist laut, aber auf eine betörende Art auch charmant. Die gesamte Handlung entspricht 1:1 einem Bond-Film der Brosnan-Ära. Tricktechnisch ist das alles A-Kino. Und die Besetzung ist perfekt. Jason Statham etwa gibt einen von seiner eigenen (nicht wirklich vorhandenen) Genialität besoffenen Superagenten – der es aber, wenn es um Action geht, es ordentlich krachen lässt; die Australierin Rose Byrne brilliert derweil als ebenso schöne wie finstere Weltenzerstörerin. Der Film steht somit auf einem soliden Grundgerüst, das nun mit Humor angereichert wird. Einem Humor, der durch eine Hauptfigur in die Story eingebracht wird, die nun auch keine Amateurin ist. Sie ist eine blitzgescheite Analystin. Was sie halt nicht ist: Eine Agentin im Außeneinsatz. Was dann zu einigen wirklich krachend komischen Situationen durch die Brechungen des zu Erwartenden führt, da Susan halt immer wieder – auf ihre Art und Weise – improvisieren muss. Von diesen Qualitäten ist «Thunder Force» leider mehr als nur ein Filmgenre weit entfernt.
Die Ausgangssituation ist nicht uninteressant. Irgendwann in den 1980er Jahren wird durch eine fremde Macht eine Energie freigesetzt, die einige Menschen mit Superkräften ausstattet. Das Problem: Für diese Energie sind nur Menschen empfänglich, die man gemeinhin als Sozio- oder Psychopathen bezeichnen würde. Bei einem Kampf zwischen zwei rivalisierenden Superschurken sterben die Eltern der jungen Emily. Emily wird daraufhin in die Obhut ihrer Großmutter gegeben, woraufhin sie auch eine neue Schule besuchen muss, auf der sie, ein ungemein strebsames (afroamerikanisches) Mädchen von den anderen Kindern gemobbt wird. Als ein Junge sie richtig mies behandelt, mischt sich ihre Mitschülerin Lydia in den Streit ein. Sie lässt dem Jungen ordentlich eine kommen – und die beiden sehr unterschiedlichen Mädchen werden beste Freundinnen.
Und unterschiedlicher könnten sie kaum sein. Auf der einen Seite ist Emily, ein Genie in den unterschiedlichsten naturwissenschaftlichen Disziplinen, strebsam, „adrett“. Auf der anderen Seite ist Lydia, die irgendwie in den Tag hineinlebt und eher etwas simpel gestrickt ist. Aber die Mädchen ergänzen sich auf ihre Weise perfekt, bis es einige Jahre später zu einem Streit kommt, in dem sich Lydia vielleicht nicht korrekt verhalten mag – es jedoch Emily ist, die ihre Freundschaft recht barsch beendet.
 Gegenwart: Lydia arbeitet als Gabelstaplerfahrerin auf einem Hafengelände in Chicago, Emily ist derweil zu einer hoch angesehenen Wissenschaftlerin und Self-Made-Milliardärin aufgestiegen. Am Tag ihres Klassentreffens – zu dem Emily nicht erscheint – macht sich Lydia kurzerhand auf dem Weg zu ihrer Jugendfreundin und ist durchaus überrascht, von dieser „empfangen“ zu werden. So erfährt Lydia, dass Emily nie aufgehört hat, ihrer wahren Passion zu folgen. Wie ihre Eltern, die Genetiker waren, arbeitet sie daran, die Kraft, die die bösen Superschurken erschaffen hat, so zu nutzen, dass sie auch guten Menschen zu Gute kommen können – damit diese sich als Superhelden den Superschurken entgegenstellen können. Und heute ist der Tag, an dem ihre Forschungen ans Ende gelangt sind. Woraufhin dem Film nun jedoch nichts weiter einfällt als eine Situation zu erschaffen, die zum Fremdschämen einlädt. Emily lässt Lydia einen Moment unbeaufsichtigt und Lydia hat natürlich nichts Schlechteres zu tun als an irgendwelchen Hebeln herumzuspielen, um dadurch versehentlich den Mechanismus auszulösen, der die „Superheldwerdung“ einläutet. Das Problem: Dieser Vorgang lässt sich mit all den zur Verfügung stehenden Ressourcen nur einmal durchführen, was bedeutet, dass Lydia nun jene Superheldin ist, die eigentlich Emily werden sollte – für die nur eine Kraft übrig bleibt: Sie kann sich unsichtbar machen. Kraft, Stärke, Ausdauer aber fließen nun durch die Adern Lydias.
Gegenwart: Lydia arbeitet als Gabelstaplerfahrerin auf einem Hafengelände in Chicago, Emily ist derweil zu einer hoch angesehenen Wissenschaftlerin und Self-Made-Milliardärin aufgestiegen. Am Tag ihres Klassentreffens – zu dem Emily nicht erscheint – macht sich Lydia kurzerhand auf dem Weg zu ihrer Jugendfreundin und ist durchaus überrascht, von dieser „empfangen“ zu werden. So erfährt Lydia, dass Emily nie aufgehört hat, ihrer wahren Passion zu folgen. Wie ihre Eltern, die Genetiker waren, arbeitet sie daran, die Kraft, die die bösen Superschurken erschaffen hat, so zu nutzen, dass sie auch guten Menschen zu Gute kommen können – damit diese sich als Superhelden den Superschurken entgegenstellen können. Und heute ist der Tag, an dem ihre Forschungen ans Ende gelangt sind. Woraufhin dem Film nun jedoch nichts weiter einfällt als eine Situation zu erschaffen, die zum Fremdschämen einlädt. Emily lässt Lydia einen Moment unbeaufsichtigt und Lydia hat natürlich nichts Schlechteres zu tun als an irgendwelchen Hebeln herumzuspielen, um dadurch versehentlich den Mechanismus auszulösen, der die „Superheldwerdung“ einläutet. Das Problem: Dieser Vorgang lässt sich mit all den zur Verfügung stehenden Ressourcen nur einmal durchführen, was bedeutet, dass Lydia nun jene Superheldin ist, die eigentlich Emily werden sollte – für die nur eine Kraft übrig bleibt: Sie kann sich unsichtbar machen. Kraft, Stärke, Ausdauer aber fließen nun durch die Adern Lydias. Wenn solch ein entscheidender Moment in einem Film so schlecht und dumm inszeniert ist wie Lydias Superheldenwerdung – vergeht im Grunde schon der Spaß am weiteren Schauen. Immerhin hat die Hauptfigur gerade nicht weniger getan als den Lebenstraum einer ehemals guten Freundin zu zerstören. Die jedoch, wie sich schnell zeigt, im Grunde mit diesem Superheldendasein vollkommen überfordert gewesen wäre, da es ihr schlicht am Mumm fehlt, mit dem Kopf voran in Konfrontationen zu gehen. Hätte man daraus nicht einen Handlungsfaden stricken können, der auf eine sanfte, weniger unsympathische und vor allem viel weniger dämliche Art Lydia zur idealen Kandidatin gemacht hätte? Dass Lydia das Herz auf dem rechten Fleck trägt und sich für Schwächere einzusetzen vermag – ist doch aus dem Prolog des Filmes bekannt. Warum wird Lydia also im Prolog auf diese sympathische Weise eingeführt, um sie später doch nur als trottelige Plumpskuh darzustellen, die durch ihr dummdöseligen Verhalten zufällig zur (tumben) Superheldin mutiert? Was zum nächsten Problem führt: Der Präsenz von Melissa McCarthy, die diesen Film produziert und deren Ehemann Ben Falcone auf dem Regiestuhl gesessen hat (wie auch schon bei Melissa McCarthys letzter Komödie «How to Party with Mom»). An sich ist die Besetzung der zweiten Hauptrolle mit Octavia Spencer clever. Die ist eher eine Charakterdarstellerin, hat 2017 für ihre Rolle in «Hidden Figures» eine Oscarnominierung erhalten – und ist damit eigentlich eine Idealbesetzung für die Rolle einer seriösen Wissenschaftlerin, die eine Mission verfolgt. Nur wird sie in der Inszenierung immer wieder hinter Melissa McCarthy zurückgedrängt, die erst ganz gegen Ende des Filmes einen Weg findet, ihre Figur zu definieren, bis dahin jedoch enervierend durch die Gegend irrlichtert und vor allem nervt – was wiederum dadurch besonders zur Geltung gelangt, dass es dem Film an so etwas wie echten Antagonisten fehlt. Da ist die franko-koreanische Schauspielerin Pom Klementieff, die als Energiestöße aussendende Schurkin mit Namen Laser grimmig blicken darf. Und da ist Bobby Cannavale, der als Bürgermeisterkandidat gegen die bösen Überschurken ins Feld ziehen will, dem jedoch schon während seines ersten Auftrittes auf die Stirn getackert steht, dass er selbst ein soziopathischer Superschurke ist. So etwas wie Charakterzeichnung kennt der Film leider nicht, daher ist es im Grunde auch gleichgültig, wer hier eigentlich gegen wen zu Felde zieht. Eine Ausnahme ist in diesem Reigen Jason Bateman – Melissa McCarthys unfreiwilliger Partner aus der Komödie «Voll abgezockt». Er spielt The Crab, einen Superschurken mit Krabbenarmen, der durch einen kleinen radioaktiven Unfall mutiert ist und im Grunde darunter leidet, als Soziopath betrachtet zu werden.
Nun soll an dieser Stelle gar nicht behauptet werden, der Film sei von A bis Z ein Debakel. Hier und da gibt es durchaus witzige Momente. Wenn die beiden Superheldinnen zu ihrer ersten Nachtfahrt ansetzen und sich dafür ausgerechnet einen italienischen Sportwagen aussuchen, der für XXL-Damen wie sie nicht unbedingt zugeschnitten ist, … dieser Moment hat was. Oder da ist ein Frontalangriff auf das Thema Kultursensibilität, das gerade die amerikanischen Linken und Liberalen umtreibt und im Grunde genommen jede Art von Humor verbietet, wenn dieser Humor jemanden verletzen könnte. Hier trifft dieses Thema jedoch The Crab bei einem Abendessen, bei dem ausgerechnet Meeresfrüchte als eine besondere Spezialität angepriesen werden. Solch hintergründigen, gar vielschichtigen Humor erwartet man in diesem Film nun wahrlich nicht; um so erstaunlicher ist dieser Moment und er zeigt, dass McCarthy und Falcone mehr können als nur plumpen Krawallwitz zu bieten. Nur warum tun sie es dann so selten?
Vielleicht, weil Falcone Momente inszenieren kann, es ihm aber am Blick für das große Ganze fehlt. «Thunder Force» hat einzelne Momente, die durchaus zum Schmunzeln oder gar zum lauten Lachen animieren. Doch es sind einzelne Szenen, die zusammen eben keinen fertigen Film ergeben, da es diesem als Gesamtwerk an Rhythmus, Plausibilität, Spannungsaufbau fehlt. An dieser Stelle sei noch einmal der Vergleich mit «Spy» erlaubt, den Paul Feig inszeniert hat. Wo «Spy» sein Ursprungsgenre ernst nimmt und dieses quasi „nur“ durch den Einsatz von Humor (liebevoll) parodiert, ist «Thunder Force» eben kein echter Superheldinnenfilm, weil es ihm eben nicht nur an echten Figuren, sondern eben auch vor allem einer echten Dramaturgie fehlt. Man möchte drei Kreuze schlagen, dass der Film keine Post-Credit-Sequenz präsentiert, die am Ende noch eine Fortsetzung androhen würde.
Der Film ist im Stream bei Netflix verfügbar.








 Ab heute wird es «heute wichtig»
Ab heute wird es «heute wichtig» Quotencheck: «Luke! Die Schule und ich – VIPs gegen Kids»
Quotencheck: «Luke! Die Schule und ich – VIPs gegen Kids»










 Logger (m/w/d) im Bereich Reality am Standort Ismaning bei München und teilweise im Ausland in befristeter Anstellung / freier Mitarbeit
Logger (m/w/d) im Bereich Reality am Standort Ismaning bei München und teilweise im Ausland in befristeter Anstellung / freier Mitarbeit Kameramann / Cutter (m/w/d)
Kameramann / Cutter (m/w/d)

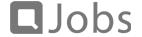

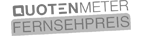
Es gibt 1 Kommentar zum Artikel
26.04.2021 17:47 Uhr 1