Wir haben das Große im Kleinen gesucht. Wie in Nahaufnahme haben wir uns mit den Herkunfts-Geschichten von neun emblematischen Objekten beschäftigt - denn hier findet man die spannenden Details: Zufall, Genie, Machtstreben, Eifersucht, Intrigen… Jede Werkbiographie ist wie ein Krimi, und in sich schlüssig. Jedes Objekt erhellt eine oder mehrere Epochen. Gemeinsam ermöglichen die Einzelkapitel es, den großen Bogen zu spannen.
Inwiefern verstehen Sie die Museumsinsel nicht nur als Bauensemble, sondern auch als Spiegelbild deutscher Geschichte?
Die Frage, warum ein bestimmtes Werk zu einem bestimmten Zeitpunkt ins Museum kommt, erzählt uns zwangsweise, was in der Gesellschaft in diesem Moment wertgeschätzt wird. Der preußische König Wilhelm IV interessiert sich für ägyptische Artefakte, weil er zeigen will, dass sein Königreich mit den Großmächten England und Frankreich rivalisieren kann, obwohl man selbst keine Kolonien hat. Ein Gemälde von Edouard Manet, ein Vorläufer des Impressionismus, wird angeschafft, weil Berlin zu dieser Zeit moderner ist als andere europäische Großstädte, und ein durch die Industrialisierung reich gewordenes Großbürgertum solche Ankäufe möglich macht.
Gerade die Zeit um 1825, die Grundsteinlegung des Alten Museums durch Schinkel, markiert den Beginn. Welche Bedeutung hat dieser Moment für die Erzählung Ihrer Dokumentation?
Die Grundsteinlegung ist der Ausgangspunkt unserer Erzählung, aber um diesen Moment zeitgeschichtlich einordnen zu können, benötigen wir einen Rückgriff: die Geschichte des „Betenden Knaben“, einer Bronzeskulptur, die ein knappes Jahrhundert zuvor angeschafft worden war und in die Zeit der napoleonischen Kriege zurück verweist, ermöglicht es uns, wirklich zu begreifen, was es damals bedeutete, ein Museum zu eröffnen.
Ihre Dokumentation beleuchtet auch, dass die Museumsinsel seit ihrer Entstehung „Dauerbaustelle“ ist. Wie haben Sie diesen Aspekt filmisch umgesetzt?
Unsere These ist, dass die Museumsinsel keine feste Identität besitzt, sondern immer im Fluss ist, wie die Spree, die sie umgibt. Sie passt sich immer den Wünschen und Projektionen derer an, die sie bauen, erweitern und um-bauen. Bildlich spiegelt sich das in vielen Aufnahmen von Wasser, Wellen, und vor allem Spiegelbildern der steinernen Architektur im Wasser. Die festen Konturen scheinen zu verschwimmen und verweisen auf die fluide Identität der Kulturinstitution.
Viele Exponate, darunter der Pergamonaltar oder das Ischtar-Tor, sind auf Jahre nicht zugänglich. Wie sind Sie im Film damit umgegangen, dass zentrale Stücke derzeit fehlen?
Ja, wir haben drei solche Objekte im Film: das Ischtar-Tor, das Aleppo-Zimmer und den Pergamonaltar. Wir hatten das Glück, diese Werke filmen zu können, obwohl sie sich gerade mitten in einer riesigen und komplexen Baustelle befinden. Es war sehr schwierig, diesen Zugang zu ermöglichen – aus Sicherheitsgründen, und aus bürokratischen Gründen. Die Direktoren und Sammlungsleiter, die auf der Museumsinsel arbeiten, haben uns dabei sehr unterstützt – ohne deren aktive Hilfe wäre der Film so niemals möglich gewesen. Wir haben über ein Jahr lang geplant und gewartet. Es mussten Momente abgepasst werden, in denen kurzfristig ein Zugang möglich war – wir haben dann quasi auf Abruf sofort gedreht. Für das Aleppo-Zimmer haben wir unser Team innerhalb von 48 Stunden mobilisiert – es war reines Glück, dass unser französischer Kameramann und Co-Regisseur gerade verfügbar war und noch am selben Tag nach Berlin fliegen konnte. So ist es gelungen, diese Werke durch den Film der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, während sie im Dornröschenschlaf liegen. Das Ischtar-Tor soll erst in den 2030er Jahren wieder zugänglich sein!
Im Vergleich zu Museen wie dem Louvre oder dem British Museum spielt die Besucherzahl eine große Rolle. Welche Schlüsse ziehen Sie aus diesem internationalen Vergleich?
Der Louvre und das British Museum waren lange das Vorbild für die Berliner Museen, die großen Rivalen, mit denen man gleichziehen wollte. Das kleine Königreich Preußen hatte aber nicht die Ressourcen und Beziehungen, die den beiden Kolonialmächten England und Frankreich zur Verfügung standen. Erst während des Kaiserreichs holte Berlin auf. Dieses internationale Kräftemessen, das sich im Imperialismus zuspitzte, hat zu zwei Weltkriegen geführt. Hier zeigt sich also wieder die Parallele zwischen Museumsgeschichte und deutscher Geschichte.
Die Museumsinsel ist UNESCO-Weltkulturerbe, aber auch ein Projekt voller Sanierungs- und Finanzierungsdebatten. Wie haben Sie die Spannungen zwischen Glanz und Problemen dargestellt?
Der Balanceakt zwischen übergroßer Ambition und geringen zur Verfügung stehenden Mitteln ist ganz charakteristisch für die Museumsinsel, von Anfang an. Das preußische Königreich träumt von einem prestigeträchtigen Projekt, das im nationalen und internationalen Vergleich mithalten kann. Der Architekt Karl Friedrich Schinkel muss diesen Traum allerdings mit sehr wenig Geld umsetzen, denn in Preußen ist man chronisch pleite. Ebenfalls von Anfang an kämpft man mit dem unsäglich schlechten Baugrund, der aufgrund einer eiszeitlichen Verformung quasi durchlöchert ist. An vielen Stellen können keine Fundamente gelegt werden. Man muss Pfähle in große Tiefen treiben und Brückenkonstrukte im Boden versenken, um das Alte Museum, das Neue Museum und vor allem das Pergamonmuseum zu stabilisieren. Mit diesen Problemen kämpfen wir ironischerweise bis heute, oder vielmehr heute wieder. Aus unserer Sicht ist es aber genau dise Herausforderung, die der Museumsinsel ihre ganz spezielle Form gibt, und in der sich die deutsche Identität spiegelt.
Mit der Figur der Nofretete verfügt Berlin über ein weltberühmtes Symbol. Welche Rolle spielen diese „Ikonen“ in der Dramaturgie Ihrer Dokumentation?
Unser Film erzählt die Geschichte von neun Werken in neun Kapiteln. Die Nofretete ist eines davon, es gibt aber auch weniger bekannte Werke in unserer Auswahl. Wichtig war uns vor allem, dass sich anhand der ausgewählten Werke möglichst viel Zeitgeschichte erzählen lässt, so dass der Zusammenhang klar wird zwischen dem Museum und der Gesellschaft, die es prägt. Bei den weltberühmten Ikonen heben wir die Aspekte hervor, die sonst nicht im Vordergrund stehen. Bei Nofretete zum Beispiel sprechen wir von der paradoxen Beziehung der Nationalsozialisten zu diesem ganz und gar „unarischen“ Meisterwerk, und davon, wie die Nofretete zum Streitobjekt zwischen BRD und DDR wurde. Beide Seiten beanspruchten die Büste für sich. Der Streit eskalierte darin, dass die DDR sich eine eigene Nofretete erfand! Man nahm dafür einen grauen Steinkopf aus Granit, der aus dem gleichen Amarna-Fund stammt. Diese „authentische, echte“ Königin wurde gegen die „aufgetakelte West-Nofretete“ ausgespielt. So wurde die Ikone zum Spiegel des Kulturkampfs während der Zeit des Eisernen Vorhangs.
Wie wichtig war es Ihnen, diese Brüche mitzuerzählen?
Aber andere wichtige historische Brüche thematisieren wir durchaus, zum Beispiel den erratische Bauprozess des Pergamonmuseums – das erste Pergamonmuseum wurde sieben Jahre nach seiner Fertigstellung komplett abgerissen und durch eine neue Planung ersetzt, deren Umsetzung mehrere Jahrzehnte dauerte – die umkämpfte Sammlung impressionistischer Kunst oder die Fertigstellung des Ishtartors nach dem ersten Weltkrieg. Die Brüche in der Museumsgeschichte sind uns vielleicht sogar wichtiger als die Kontinuitäten, denn in ihnen offenbart sich ja die fluide Identität der Museumsinsel. Diese fünf Museen sind kein abgeschlossenes Ensemble in Stein, sondern eine lebendige Kulturinstitution, die sich immer wieder der veränderten Gesellschaft anpasst. Die Museumsinsel ist ein Spiegelbild des Wandels der Zeit.
Digitalisierung und künstliche Intelligenz sollen künftig helfen, Sammlungen zu erschließen. Sehen Sie in solchen Entwicklungen Chancen oder eher Risiken für die klassische Museumsarbeit?
Beides. KI und digitale Instrumente sind immer so gut wie ihre Benutzer. Wir haben durch dieses Projekt teilweise außergewöhnlich engagierte Museumsdirektoren und -mitarbeiter kennengelernt, die trotz oder gerade wegen ihrer Leidenschaft für die betreute Sammlung durchaus abstrahieren und in kritischer Distanz zur Museumsarbeit stehen. Sie wissen, dass sie sich immer wieder neu erfinden müssen, um relevant zu bleiben, um vom Fluss der sich stetig wandelnden Identität der Museumsinsel nicht verschluckt zu werden, wenn man so will. Ich bin zuversichtlich, dass diese Leute es schaffen werden, mit den neuen Instrumenten, die ihnen nun zur Verfügung stehen, kreativ und gewinnbringend umzugehen. Um die, die es nicht schaffen, ist es nicht schade.
Ihre Doku erscheint zum 200-jährigen Jubiläum der Museumsinsel. Gab es für Sie beim Drehen einen besonderen Moment, in dem Sie selbst die „Magie“ des Ortes gespürt haben?
Wir haben die Kunstwerke meist bei Nacht gedreht, wenn keine Besucher im Museum sind. Man muss sich vorstellen, dass dann ein fünf- bis siebenköpfiges Team in Begleitung eines eigens von der Museumsverwaltung zur Verfügung gestellten Sicherungsdienstes im geschlossenen und dunklen Museum mit Kabeln und Lampen hantiert. Etwa drei Stunden dauert es, bis wir die gewünschte Atmosphäre geschaffen haben, erst dann wird das erste Bild gedreht. Dann wird das Licht wieder umgebaut, für die nächste Einstellung. Es ist eine sehr kleinteilige, mühsame Arbeit. Das Ziel ist dabei nicht unbedingt, Magie zu spüren, sondern sie für den Zuschauer zu erschaffen. Jede Aufnahme muss sitzen, und genau zu dem Inhalt passen, den wir erzählen wollen, um die Emotionen zu wecken, die unseren Film tragen.
Es gibt aber trotzdem immer wieder Momente, wo das Team kurz aufblickt und Magie spürt. Eine Nacht alleine mit Nofretete im Kuppelsaal zu verbringen, ist schon etwas Besonders. Ich hatte damals meine zwei Monate alte Tochter dabei, die in der Wiege unter der Büste schlief und ab und zu gestillt werden wollte. Dann saß ich da mit ihr auf der Bank, und verstand auf einmal, warum man der Nofretete eine „Aura“ zuspricht. Ein anderer solcher Moment war, als wir die Erlaubnis bekamen, mit der Drohne am Pergamonaltar entlang zu fliegen, der damals noch mitten in einer Baustelle stand. Die so entstandenen dynamischen Aufnahmen mit kontrastreichem Licht sind so spektakulär, dass wir es selbst kaum glauben konnten.
Welche Botschaft wünschen Sie sich, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer aus «Museumsinsel Berlin – Geschichte einer Nation» mitnehmen?
Ich hoffe, dass der Film einen fruchtbaren Dialog darüber anstößt, wer wir als Deutsche mit diesem Museum sein wollen. Die Fronten in Kulturdebatten sind aktuell sehr verhärtet, und über den immer gleichen Themen vergisst man häufig die Neugierde, die Freude am Schaffen und Entdecken. Kann man die Bedeutung dieser Werke vielleicht noch anders framen, als es bisher geschehen ist? Welchen Aspekt haben wir bisher außen vorgelassen? Wie können wir aus der Vergangenheit etwas ableiten, das für uns heute inspirierend ist? Unsere Gesellschaft ist dabei, sich neu zu erfinden, und das kann ein faszinierender und freudvoller Prozess sein, bei dem wir alle gemeinsam unseren Kulturinstitutionen eine neue vorübergehende Form geben. Wir sind alle Teil des großen Flusses dieser sich ständig wandelnden Identität. Ich hätte gerne, dass der Film Menschen dazu bringt, nicht länger mäkelnd am Ufer zu stehen, sondern jauchzend ins Wasser zu springen. Ich wünsche mir, dass der Film dazu anregt, ins Museum zu gehen, sich eine Beziehung zu den Werken aufzubauen, und aktiv mitzudenken, was sie im heutigen Kontext bedeuten sollen.
«Museumsinsel Berlin - Geschichte einer Nation» ist bereits in der arte-Mediathek abrufbar. Die Dokumentation ist am Sonntag, den 21. September, um 15.50 Uhr bei arte zu sehen.







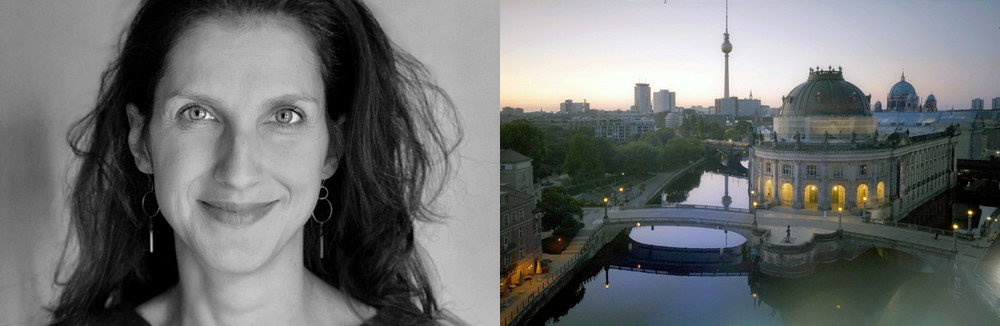


 «La Brea»: Gesamte Serie ab Oktober kostenlos bei TF1+
«La Brea»: Gesamte Serie ab Oktober kostenlos bei TF1+ Neue Folgen von «Detektiv Conan»
Neue Folgen von «Detektiv Conan»









 Kreditoren-Buchhalter (m/w/d)
Kreditoren-Buchhalter (m/w/d) Studentische Aushilfe (m/w/d) ? YouTube-/Twitch-Team
Studentische Aushilfe (m/w/d) ? YouTube-/Twitch-Team




Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel