Kurz vor meinem Abitur habe ich erstmals von Gedächtnistechniken gehört und habe diese ausprobiert. Schnell war ich begeistert, wie gut diese funktionieren. Darum suchte ich immer weiter und stieß bald auf den Gedächtnissport. Die enorme Verbesserung in messbaren Aufgaben wie Zahlen oder Spielkarten merken, schnell kann man hier zehnmal und mehr so viel behalten wie vorher, hat mich motiviert, die Turniere und der Austausch mit anderen riesigen Spaß gemacht und bald kamen auch erste Erfolge. Als ich einige Jahre später mit dem Studium fertig war, gehörte ich schon zur Weltspitze im Sport. Nur: Warum die Techniken so gut funktionieren, dazu fand ich fast nichts. So bin ich selbst in diese Forschungsrichtung gegangen.
Sie sind regelmäßig in Fernsehsendungen zu sehen – wie gelingt es Ihnen, wissenschaftlich komplexe Themen rund ums Gehirn für ein breites Publikum verständlich zu machen?
In der Forschung, gerade auf Fachkonferenzen, hatte ich ähnliche Momente der Begeisterung
wie beim ersten Kontakt mit Gedächtnistechniken. „Aber warum weiß das dann keiner?“ war die neue Frage in meinem Kopf. Was einem selbst beim Lernen hilft, hilft auch beim Vermitteln! So begann ich erst über Science Slams, dann mit eigenen Vorträgen und Büchern, die Inhalte auch allgemeinverständlich zu erklären und habe dabei natürlich beobachtet, was funktioniert und was nicht.
Welche Rolle spielt die mediale Vermittlung bei der Aufklärung über unser Gehirn – und was machen Medien Ihrer Meinung nach dabei richtig oder falsch?
Eine große Rolle. Darum trete ich auch bewusst in den unterschiedlichsten Formaten auf. Vom «ZDF-Fernsehgarten», wo ich inzwischen elf Mal war, bis zu wissenschaftlichen Formaten. Natürlich bin ich dankbar, dass meine Bücher eine gewisse Reichweite haben. Aber mit einem einzigen TV-Auftritt erreicht man heute noch Millionen Menschen. Bilder und Geschichten funktionieren immer gut. Leider auch die falschen. So bleiben Mythen wie „logische und kreative Gehirnhälfte“ oder „wir nutzen nur 10% von unserem Gehirn“ hängen, auch wenn sie falsch sind. Hier wäre es schön, wenn Medien etwas mehr prüfen, bevor sie es weitererzählen.
In einer Welt voller digitaler Reize und permanenter Ablenkung: Was passiert da eigentlich mit unserem Gehirn – und wie können wir im Alltag gegensteuern?
Unser Gehirn ist ein echtes Wunderwerk – aber es stammt evolutionär gesehen aus einer Zeit, in der wir uns um ein paar wenige, dafür echte Gefahren kümmern mussten. Wilde Tiere, Unwetter etc. Heute prasseln pausenlos Reize auf uns ein. WhatsApp-Nachrichten, E-Mails, Streaming-Angebote. Und das Gehirn reagiert darauf, als wären es alle kleine Gefahren. Der Fokus springt ständig zwischen Aufgaben, Alarmen, schnellen Bildern hin und her wird unruhiger, müder, weniger aufnahmefähig.
Was hilft? Bewusste Entlastung. Kein ständiges Multitasking, was eh nicht geht, sondern eine Sache nach der anderen. Klare To-dos statt offener Tabs. Und ganz wichtig: Reizarme Pausen, in denen das Gehirn aufräumen kann – auch mal ganz ohne Bildschirm. Schon ein paar Minuten Pause, ohne, dass wir uns gleich auf etwas andere konzentrieren, helfen. Also auch mal auf einen Baum gucken statt aufs Display.
Sie sprechen oft über die Fähigkeit, sich gezielt Dinge besser zu merken. Gibt es Techniken, die sich besonders gut für Medienkonsum und Informationsflut eignen – etwa beim Scrollen durch Newsfeeds oder Videos?
Ja – und die wichtigste Technik ist vielleicht die einfachste: bewusste Aufmerksamkeit. Wenn wir durch Newsfeeds scrollen oder uns durch Kurzvideos klicken, rauschen die Inhalte meist einfach durch. Unser Gehirn nimmt zwar alles wahr, aber speichert fast nichts, weil es keine Relevanz erkennt. Sieht ja erstmal alles gleich aus. Mein Tipp: Sobald dir etwas auffällt – ein spannender Fakt, ein ungewöhnliches Bild, eine neue Information –, halte innerlich kurz inne und sag dir selbst: „Das war interessant.“ Schon dieser Moment des bewussten Markierens hebt die Info im Gedächtnis hervor.
Noch effektiver wird’s mit dem Ausnutzen des sogenannten Testing-Effekt: Woran du dich selbst erinnerst, wird danach viel besser abgespeichert, das geht auch ganz kurz nach der Informationsaufnahme. Frag dich also nach dem Lesen eines Artikels oder nach dem Anschauen von einem Video ganz simpel: Worum ging es da eigentlich? Oder: Was nehme ich daraus mit? Dieses kurze Abrufen sorgt dafür, dass dein Gehirn aktiv arbeitet – und nicht nur passiv konsumiert. Und so nachhaltiger abspeichert.
Wie verändert sich unser Gedächtnis durch den ständigen Zugriff auf digitale Speicher – verlernen wir wirklich das Erinnern?
Was wir beobachten, ist kein Gedächtnisverlust – sondern eine Verlagerung. Unser Gehirn merkt sich heute nicht mehr alles, sondern vor allem, wo es etwas finden kann, sofern es davon ausgeht, dass die Information dort weiter vorhanden ist. Das nennt man in der Forschung den Google-Effekt: Wir erinnern uns weniger an Fakten, dafür besser an Speicherorte. Das kann praktisch sein – aber es hat auch einen Preis!
Denn echtes Verstehen entsteht nicht durch Nachschlagen, sondern durch Verknüpfen. Wer Wissen nur googelt, aber nie selbst verarbeitet, baut keine stabilen Netzwerke im Gehirn auf. Und ohne diese Netzwerke fehlt uns später der Überblick, das Mitdenken, das kreative Kombinieren. Genau deshalb lohnt es sich, bewusst zu entscheiden: Was will ich wirklich behalten? Und diese Inhalte dann aktiv zu lernen – mit Bildern, Wiederholung und Struktur.
Viele kennen Sie aus TV-Formaten – darunter Quizsendungen oder Wissenschaftssendungen. Welche mediale Darstellung des Gehirns hat Sie besonders beeindruckt – und welche eher geärgert?
Die Dokumentation «Reine Kopfsache» mir Nora Tschirner, die ich für VOX begleiten und darin auftreten durfte, hat mir einerseits viel Spaß gemacht und andererseits meiner Meinung nach gut hinbekommen, wissenschaftliche Korrektheit und Verständlichkeit gut zu kombinieren.
In kurzen Einspielern in Quizsendungen ist die tiefe natürlich begrenzt, aber es ist trotzdem toll, wenn ein paar Wissenshappen hängen bleiben. Was mich manchmal ärgert ist, wenn dann – oft gut gemeint – Sprüche der Moderation oder prominenten Gäste folgen, dass die Gedächtnissportlerinnen und -sportler oder Spitzenquizzer ja doch Superhirne oder Genies sein und so das Bild hängen bleibt, dass können nur die wenigsten. Stimmt aber nicht: Alle können von der richtigen Benutzung des Gehirns und zum Beispiel Merktechniken enorm profitieren!
In Vorträgen motivieren Sie Menschen dazu, das Potenzial ihres Gehirns auszuschöpfen. Was sind Ihre wichtigsten drei Tipps für mentale Leistungssteigerung im Alltag?
Mein Ziel ist, dass die Menschen schon im Vortrag erleben, dass sie deutlich mehr können, als sie sich vorher zutrauen. Der erste wichtige Tipp ist dabei das Denken in Bildern: Bilder, Emotionen werden einfach tiefer und anders verarbeitet als Sprache. Daher hilft es sich Dinge vorzustellen. Das lässt sich auf vieles Übertragen. Wer sich etwa einen Namen merken will, sollte sich etwas vorstellen. Frau Fischer sehe ich vor dem inneren Auge beim Fischen, statt nur den Namen zu hören, Herrn Zverev mit seinem Namensvettern Tennis spielen.
Tipp 2, neben im Alltag sein Gedächtnis trainieren. Etwa das Namen merken lässt sich super auch beim Medienkonsum nutzen. Wer achtet schon drauf, wie der Quizshowkandidat heißt? Einfach mal tun und sich bewusst was dazu vorstellen. Und fünf Minuten später freuen: Ich weiß noch wie der heißt!
Der dritte Tipp, kostet etwas Mühe, bringt aber enorm viel: Bau dir einen Gedächtnispalast! Also einen festen Weg, zum Beispiel durch die eigene Wohnung, mit festen Wegpunkten. Ich empfehle immer 50. Klingt total viel, ist aber machbar. 10 im Schlafzimmer, 10 in der Küche usw. Diesen Weg kann man sich dann immer gedanklich vorstellen, wenn man sich etwas merken möchte. Von einfachen Listen bis zu Fachinformationen oder ganzen Vorträgen. Braucht etwas Übung, ist aber genau die Technik die selbst Gedächtnisweltrekordler nutzen.
Wenn Sie das deutsche Bildungssystem im Hinblick auf Gedächtnisförderung betrachten: Was läuft gut – und wo sehen Sie Nachholbedarf, auch mit Blick auf Medienkompetenz?
Was gut läuft: Es gibt viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die sich für neue Lernmethoden und wissenschaftliche Erkenntnisse interessieren und von denen manche auch Gedächtnistechniken integrieren. Ich erlebe das oft bei Schulworkshops oder in Fortbildungen: Die Neugier ist da, der Wunsch nach alltagspraktischen Werkzeugen ebenfalls.
Was fehlt, ist die systematische Verankerung. Der Raum neue Erkenntnisse über Lernen und Gedächtnis zu integrieren, dafür auch moderne Technologie zu benutzen, ist viel zu klein. Dabei sind die Grundlagen einfach vermittelbar – und sie helfen nicht nur beim Merken von Fakten, sondern stärken auch Konzentration, Selbstvertrauen und Motivation.
Auch beim Thema Medienkompetenz sehe ich Luft nach oben. Schüler wachsen heute in einer digitalen Welt auf, doch oft ohne Anleitung, wie man sinnvoll damit umgeht. Die Herausforderung, dass im Durchschnitt die Schüler nur als Beispiel KI-Tools viel besser verstehen und anwenden als die Lehrkräfte, gab es bei uns mit dem damals neuen Internet, dann mit YouTube usw. und wird bei allem neue gelten. Anstatt das mit Regeln verhindern zu wollen, weil die Erwachsenen nicht hinterher kommen, bräuchten mehr Fokus auf gemeinsam entdecken. Auf Kompetenz beim Hinterfragen. Nicht die KI verbieten, sondern entdecken lassen, wo sie falsch liegt. Die Frage mitgeben: Wie kannst du es denn einsetzen, dass es nicht statt dir deine Hausaufgabe macht – du also nichts mehr tust und lernst -, sondern dass du es dank der KI selbst schneller lernst als alle Generationen vor dir?
Zum Tag des Gehirns: Was wünschen Sie sich persönlich – von der Gesellschaft, der Politik, aber vielleicht auch von den Medien – im Umgang mit diesem faszinierenden Organ?
Ich wünsche mir, dass wir das Gehirn nicht nur als Objekt der Forschung, sondern als Schlüssel zu Bildung, Gesundheit und Zukunft begreifen. Es ist das einzige Organ, das über sich selbst nachdenken kann – und von der ersten bis zur letzten Sekunde nichts anderes macht als sich zu verändern, also: Als zu lernen.
Von der Politik wünsche ich mir mehr Investitionen in frühzeitige Förderung geistiger Fähigkeiten. Mehr Raum für Konzentration, Kreativität und Gedächtnistraining in Schulen – also nicht nur Arbeit am „Was“ als Inhalt unterrichtet wird, sondern am Entdecken „Wie“ Lernen an sich funktioniert. Von den Medien wünsche ich mir, dass sie die Faszination für das Gehirn nutzen, um nicht nur spektakuläre Schlagzeilen zu verbreiten, sondern auch aufzuklären: über Mythen, über Möglichkeiten, über das enorme Potenzial, das in jedem Menschen steckt.
Und von der Gesellschaft? Den Mut, sich wieder mehr zuzutrauen. Unser Gehirn ist kein Muskel, der sich mit dem Alter abbaut – sondern ein Netzwerk an Nervenzellen, das ein Leben lang erfolgreich arbeiten und sich leistungsmäßig noch steigern kann. Aber eben nur, wenn wir es nutzen.
Vielen Dank für Ihre Zeit!
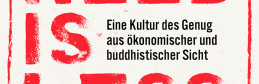







 Buchclub: ‚Viermal ICH‘
Buchclub: ‚Viermal ICH‘ Ozzy Osbourne ist tot
Ozzy Osbourne ist tot










 Kameramann / Cutter (m/w/d)
Kameramann / Cutter (m/w/d)




Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel