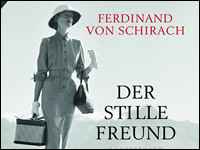 Mit „Der stille Freund“ legt Ferdinand von Schirach im August 2025 seinen neuesten Erzählband vor. Der Luchterhand Literaturverlag veröffentlicht ein Werk, das sich nahtlos in das bisherige Schaffen des Autors einfügt und es gleichzeitig erweitert. Nach „Kaffee und Zigaretten“ und „Nachmittage“ knüpft er wieder an die Form kurzer Prosa an – literarische Miniaturen, Reflexionen, Erinnerungen und Episoden, die zusammen ein Mosaik der conditio humana ergeben.
Mit „Der stille Freund“ legt Ferdinand von Schirach im August 2025 seinen neuesten Erzählband vor. Der Luchterhand Literaturverlag veröffentlicht ein Werk, das sich nahtlos in das bisherige Schaffen des Autors einfügt und es gleichzeitig erweitert. Nach „Kaffee und Zigaretten“ und „Nachmittage“ knüpft er wieder an die Form kurzer Prosa an – literarische Miniaturen, Reflexionen, Erinnerungen und Episoden, die zusammen ein Mosaik der conditio humana ergeben.Wie immer bei Schirach sind die Themen universell, aber zugleich zutiefst persönlich: Schuld und Verbrechen, Tod und Vergänglichkeit, Musik und Kunst, Philosophie und Gesellschaft. Der Autor verwebt in seinen Texten Beobachtungen aus dem Alltag mit historischen Rückgriffen und Reflexionen über große Persönlichkeiten. Leser begegnen etwa dem deutschen Tennisspieler Gottfried von Cramm, der in den 1930er-Jahren als begnadeter Sportler galt und doch an der Homophobie des NS-Staates zerbrach. Oder dem Architekten Adolf Loos, einer Schlüsselfigur der Moderne, dessen Werk und Persönlichkeit bis heute ambivalente Reaktionen hervorrufen. Auch der Wiener Schriftsteller und Kulturphilosoph Egon Friedell, der 1938 den Nazis zu entkommen versuchte und in den Tod sprang, wird Teil dieser Erzählungen.
Diese historischen Figuren sind für Schirach keine bloßen Anekdotenlieferanten, sondern Projektionsflächen für zeitlose Fragen: Was bedeutet Würde? Wo beginnt Schuld? Wie weit trägt der Mensch seine Freiheit?
Die Texte spielen in Städten, die selbst Schauplätze von Geschichte und Geschichten sind. Berlin mit seiner Zerrissenheit zwischen Moderne und Erinnerung, Rom und Wien als Metropolen europäischer Kulturgeschichte, die Côte d’Azur mit ihrer trügerischen Leichtigkeit und Kapstadt, wo die Brüche der Gegenwart in besonderer Schärfe sichtbar werden. Orte sind für Schirach nie nur Hintergrund, sondern Atmosphäre, Verdichtung und Resonanzraum.
„Der stille Freund“ ist vor allem eine Sammlung über die Verletzlichkeit des Menschen. Schirach zeigt Triumphe und Niederlagen, große Gesten und kleine Schwächen. Er erzählt von Zufällen, die Biografien aus der Bahn werfen, von Begegnungen, die ein Leben in neue Richtungen lenken. Immer wieder betont er die Unberechenbarkeit des Daseins: dass Sicherheit oft nur Illusion ist und dass Freiheit stets auch Risiko bedeutet. Diese Erzählungen folgen keiner linearen Handlung, sondern bewegen sich wie lose verbundene Fragmente um zentrale Motive. Gerade diese Offenheit macht ihren Reiz aus: Philosophische Miniaturen, die wie beiläufig hingestreut wirken, aber lange nachhallen.
Schirach bleibt seinem unverwechselbaren Stil treu: knapp, klar, fast spröde formuliert – eine Sprache, die durch Reduktion wirkt. Jeder Satz sitzt, jeder Absatz ist präzise gesetzt. Keine überflüssigen Ausschmückungen, keine Effekthascherei. Stattdessen eine Konzentration auf den Kern, die Leser dazu zwingt, die Leerstelle selbst zu füllen. Gerade in dieser Kargheit entfalten die Texte ihre Intensität. Wer Schirach kennt, weiß, dass seine Erzählungen oft so wirken, als seien sie Gerichtsprotokollen nachempfunden: nüchtern, analytisch, aber von einer tiefen Humanität durchzogen. Auch in „Der stille Freund“ zeigt sich diese Haltung: Die Texte urteilen nicht, sie beschreiben. Sie lassen Raum für Zweifel, für Ambivalenz – und fordern die Leser auf, selbst Stellung zu beziehen.
Interessant ist, dass „Der stille Freund“ nicht nur als Buch, sondern auch als Grundlage für Schirachs neues Bühnenprogramm dient. Ab Herbst 2026 wird der Autor mit einer Lesereise durch Deutschland, Österreich und die Schweiz touren. Dass seine Texte auf der Bühne wirken, hat er bereits mehrfach bewiesen: Sie leben von ihrer Knappheit und Präzision, die beim Vortrag fast noch stärker zur Geltung kommen. Man darf gespannt sein, wie Schirach das Wechselspiel zwischen Literatur und Performance diesmal gestalten wird.
Viele der Motive sind vertraut: Schuld, Gerechtigkeit, die Fragilität menschlicher Existenz. Doch „Der stille Freund“ setzt neue Akzente. Es ist ein Buch, das noch stärker als frühere Werke von Zufall und Schicksal erzählt. Während frühere Bände oft den Blick auf Täter und Opfer in der Justiz richteten, bewegt sich dieser Band freier zwischen Alltag und Geschichte, zwischen Biografie und Philosophie.
Der Titel selbst – „Der stille Freund“ – deutet an, worum es geht: um jene unsichtbare Begleitung, die das Leben prägt. Mal ist es die Erinnerung, mal die Schuld, mal der Zufall. Immer ist es etwas, das sich nicht kontrollieren lässt, das uns aber formt.
„Der stille Freund“ richtet sich an alle, die Schirachs klare, reduzierte Prosa schätzen, aber auch an Leser, die über das rein Literarische hinaus philosophische Impulse suchen. Es ist kein Roman, der eine durchgehende Handlung bietet, sondern eine Sammlung von Gedanken und Erzählungen, die man Stück für Stück lesen kann. Gerade in der Fragmenthaftigkeit liegt seine Stärke: Jeder Text ist ein Aufbruchspunkt für eigene Reflexionen. Es ist keine leichte Kost, aber auch kein schweres akademisches Werk. Vielmehr ist es eine Sammlung kluger, präziser, berührender Miniaturen, die sich gleichermaßen zum stillen Lesen wie zum lauten Vortrag eignen. Wer verstehen möchte, warum Schirachs Bücher seit Jahren so erfolgreich sind, findet hier die Antwort: Sie sind schlicht, aber nicht simpel. Sie sind ernst, aber nie belehrend. Sie sind fragmentarisch – und gerade darin universell.




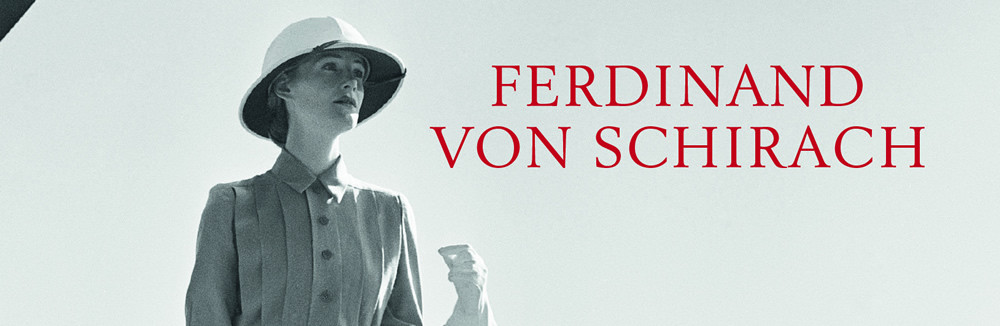



 Sinclair-Stationen lassen «Jimmy Kimmel Live!» vorerst ausfallen
Sinclair-Stationen lassen «Jimmy Kimmel Live!» vorerst ausfallen Nur 1,51 Millionen: «Hart aber fair» bleibt schwach
Nur 1,51 Millionen: «Hart aber fair» bleibt schwach








 Manager E-Mail Marketing (m/w/d)
Manager E-Mail Marketing (m/w/d) Kreditoren-Buchhalter (m/w/d)
Kreditoren-Buchhalter (m/w/d) Studentische Aushilfe (m/w/d) ? YouTube-/Twitch-Team
Studentische Aushilfe (m/w/d) ? YouTube-/Twitch-Team




Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel