Die Ausgangslage ist klar und brutal: Der Klimakollaps hat den Planeten versenkt, die Menschheit versucht ihr Glück im All – doch im Weltraum können keine Kinder mehr gezeugt werden. Also gründete man das Lazarus-Projekt: eine gigantische Anlage, in der menschliche „Samen“ künstlich gezüchtet, aufgezogen und später mit Raketen in den Orbit geschossen werden sollen. Genau dieses System ist zusammengebrochen, als der Roboter-Protagonist nach langer Stille wieder aktiviert wird. Eine Stimme im Kopf – oder im System – erklärt: Nur wenn der Caretaker das Projekt reanimiert, hat die Spezies noch eine Chance.
Spielerisch verbindet «The Last Caretaker» klassisches Survival-Crafting mit einer starken Erkundungs- und Story-Komponente. Im Zentrum steht eine mobile Plattform – eine Art schwimmende Basis –, mit der die weite Ozeanwelt bereist wird. Wracks, verlassene Türme, eingestürzte Plattformen und vergessene Anlagen warten darauf, untersucht und ausgeschlachtet zu werden. Aus Metall, Elektronikschrott, Energiezellen und seltenen Ressourcen entsteht nach und nach ein komplexes System aus Werkbänken, Reaktoren, Verteidigungsanlagen und Versorgungsmodulen. Der Clou: Ressourcen sind knapp und alles, was gebaut wird, hat Konsequenzen. Wer sich verzettelt, kann wichtige Komponenten fehlen lassen – und gefährdet damit buchstäblich die letzten Menschen.
Im Herzen des Spiels steht der Lazarus-Komplex, die stationäre Zentrale, in der die menschlichen Samen reifen. Hier wird es ungewohnt „biologisch“ für ein Spiel, in dem man eigentlich eine Maschine steuert. Inkubationstemperatur, Nährstofffluss, Sauerstoffversorgung, Datenintegration – all diese Faktoren müssen überwacht und feinjustiert werden, damit die Biopods funktionieren. Jede Kapsel trägt nicht nur biologisches Material, sondern auch Erinnerungsfragmente, alte Daten und emotionale Imprints. Beim „Aufziehen“ dieser Menschen entdeckt der Spieler nach und nach Bruchstücke vergangener Leben, gescheiterter Missionen, vergessener Beziehungen. Das verleiht der abstrakten Rettungsmission ein unerwartet persönliches Gewicht.
Doch der Lazarus-Komplex ist alles andere als sicher. Rogue Machines, also fehlgeleitete oder korrodierte Automaten, patrouillieren durch die Ruinen, stürmische Wetterphänomene greifen die Anlage an, Systemfehler führen zu Ausfällen. Hier kommt der zweite große Pfeiler ins Spiel: Schutz und Verteidigung. Der Caretaker muss automatisierte Geschütze, Sensoren und Barrieren bauen, die Basis aufrüsten und sein eigenes Chassis verbessern. Kämpfe laufen aus der Ich-Perspektive, sind aber eher taktisch und ressourcengetrieben als reine Ballerei. Wer munter Energie verschwendet, steht später bei einem größeren Angriff mit leeren Akkus da.
Das übergeordnete Ziel ist ambitioniert: Sobald genügend Menschen „hergestellt“ und stabil sind, sollen sie mit Hilfe des MOSES-Systems – einer alten Raketeninfrastruktur – in den Orbit geschickt werden. Dadurch erweitert sich das Crafting um Raketenfuel, Navigationseinheiten, Reparaturen an Startplattformen und die Suche nach Startcodes. Jeder Launch ist riskant: Schlägt er fehl, sind Monate an Ressourcen und Arbeit verloren. Gelingt er, verlässt ein kleiner Schwung neuer Menschen die Dystopie – und man spürt den Fortschritt nicht nur in Zahlen, sondern auch emotional.
Atmosphärisch setzt «The Last Caretaker» auf leise, melancholische Science-Fiction. Statt Dauerbeschallung und Marker-Overkill herrschen weite Horizonte, ruhige Soundscapes und das Dröhnen des Meeres. Die Musik unterstreicht eher Einsamkeit und Nachdenken als heroische Posen. Die Welt wirkt schwer, alt und verbraucht – eine Kulisse, in der jeder Lichtpunkt, jede funktionierende Anlage fast schon wie ein kleines Wunder wirkt. Das alles passt zur Grundidee, das Genre Survival nicht als „Ich gegen alles“, sondern als „Letzte Verantwortung für alle“ zu erzählen.
Mechanisch sticht der Titel vor allem durch seine Konsequenz hervor: Jede Entscheidung wird ernst genommen. Eine falsch geplante Produktionskette, zu viel Energie in Verteidigung statt in Brutstationen, eine riskante Expedition mit zu wenig Ressourcen – all das kann später auf die Füße fallen. Gleichzeitig zwingt das Spiel nicht in Hektik, sondern gibt Zeit, Systeme zu verstehen und nach und nach zu verfeinern. Wer Freude an Titeln wie Subnautica oder Frostpunk hat, aber eine andere Perspektive sucht, dürfte sich hier zuhause fühlen.
Bemerkenswert ist auch, wie sehr «The Last Caretaker» die Maschine als Hauptfigur ernst nimmt. Der Caretaker muss nicht essen, nicht schlafen, nicht atmen – stattdessen wird Energie gemanagt, Schäden werden repariert, Batterien geladen. Das verschiebt den Fokus im Survival-Genre und sorgt für eigene Spannungsmomente, etwa wenn die Energieversorgung zusammenbricht, während gleichzeitig eine Sturmfront aufzieht und die Verteidigungssysteme anlaufen müssten.
Unterm Strich ist «The Last Caretaker» eine nachdenkliche, technisch anspruchsvolle Interpretation von Survival-Crafting. Weniger ein Spiel über das bloße Überleben, mehr ein Spiel über Verantwortung, Timing und die Frage, was es überhaupt bedeutet, „die Menschheit zu retten“, wenn man selbst gar kein Mensch ist.







 Quotencheck: «The Voice of Germany»
Quotencheck: «The Voice of Germany» Das Ende von «Homeland»: Nach Brody war die Luft raus
Das Ende von «Homeland»: Nach Brody war die Luft raus








 Praktikant im Bereich Redaktion in unserem Format "Shopping Queen" (m/w/d)
Praktikant im Bereich Redaktion in unserem Format "Shopping Queen" (m/w/d) Mediengestalter Bild & Ton / 2nd Broadcast Operator (m/w/d)
Mediengestalter Bild & Ton / 2nd Broadcast Operator (m/w/d) Initiativbewerbungen (m/w/d)
Initiativbewerbungen (m/w/d)

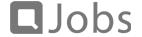

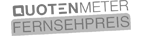
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel