Wer fragt, „wie stark beeinflussen Medien unser Körperbild“, muss zuerst fragen: „Tun sie das überhaupt“? Sind Medien die Ursache für Störungen des Körperbildes? Um diese Frage richtig zu beantworten, muss man sie genau verstehen. Der Begriff „Medien“ ist sehr ungenau. Im Kontext dieser Frage werden Medien mit Formaten assoziiert wie «Germany’s Next Topmodel», «The Biggest Loser», «Der Bachelor», «The Swan», «Gute Zeiten, schlechte Zeiten», «Extrem schwer», «Extrem schön». Zählen etwa alle Filme mit gutaussehenden Schauspielern dazu?
Körperbildstörungen sind komplexe psychiatrische Krankheiten. Die Betroffenen leiden unter einem Makel, der objektiv gar nicht existiert. Das ist der entscheidende Unterschied zu realen Problemen wie Übergewicht. Deshalb reicht bloßes Fragen nach dem Leidensdruck nicht aus. Man muss objektiv prüfen – was leider nicht immer gemacht wird. Während beim Gewicht die Waage genügt, braucht es bei körperlichen Details einen erfahrenen Spezialisten mit tiefem anatomischem Wissen. Erst wenn der Makel objektiv fehlt, sprechen wir von einer Störung. Das ist etwas ganz anderes als nur ein niedriges Selbstwertgefühl.
Viele glauben, dass «Germany’s Next Topmodel» Magersucht auslöse, weil die Darstellerinnen magersüchtig seien. Bisweilen scheint das eher ein Glaube als eine überprüfbare Tatsache zu sein. Auch wenn es sich für viele „richtig anfühlt“, einen direkten Zusammenhang zwischen «Germany’s Next Topmodel» und Körperbildstörungen anzunehmen, sind solche Zusammenhänge in der Realität deutlich komplexer. Ähnlich einfache Erklärungen kennt man aus anderen Debatten, etwa bei der Frage nach Handys und Gehirntumoren oder Impfungen und Autismus. Falsche Informationen zu akzeptieren, solange sie sich „richtig anfühlen“ ist gefährlich. Es lenkt von den wahren Ursachen ab und verhindert so die wirksame Hilfe, die die Betroffenen eigentlich brauchen.
Um die Sendung wirklich als alleinigen Verursacher zu benennen, müssten viel mehr Beweise auf dem Tisch liegen, die wir schlicht nicht haben. Man muss sich das mal ganz praktisch vorstellen: Wenn die Sendung der Auslöser wäre, hätten wir nach dem Start im Jahr 2006 einen sprunghaften Anstieg der Diagnosen sehen müssen. Das zeigen die Statistiken aber nicht. Auch die Annahme, dass jemand kränker wird, je länger er zuschaut, lässt sich wissenschaftlich nicht belegen. Zwar gibt es Studien, die das vermuten, aber große Überprüfungen zeigen immer wieder, dass diese Untersuchungen oft handwerkliche Fehler haben und deshalb kaum aussagekräftig sind.
Wir dürfen zudem die Biologie nicht vergessen. Wir wissen heute, dass bei dieser Krankheit die Gene – also die Veranlagung – zu 40 bis 50 Prozent eine Rolle spielen. Die Vorstellung, man könnte sich eine Körperbildstörung einfangen, nur weil man stundenlang eine Folge nach der anderen schaut, gehört eher ins Reich der Fantasie als in die Wissenschaft. Wäre die Sendung tatsächlich das Gift, dann müsste der Verzicht auf Medien ja das Gegengift sein. Es gibt aber keine Fälle, in dem ein Medienverbot allein eine Körperbildstörung geheilt hätte. Hoher Medienkonsum kann sicher zu Bewegungsmangel und Schlafmangel führen, aber er erzeugt keine neue psychiatrische Krankheit.
Die Annahme, Medien könnten Schönheitsideale festlegen und gleichzeitig Krankheiten verursachen, überschätzt ihre Wirkung erheblich. Sind Jungendlichkeit und Symmetrie attraktiv, weil die Medien jugendliche Moderatoren mit symmetrischen Gesichtern präsentieren, oder sehen wir überwiegend jugendliche Moderatoren mit symmetrischen Gesichtern in den Medien, weil wir sie attraktiv finden? Sind wir deprimiert, weil wir die sozialen Medien nutzen oder nutzen wir die sozialen Medien, weil wir deprimiert sind? Wir müssen vorsichtig sein mit einfachen Erklärungen.
Internationale Top-Experten kommen in angesehenen Fachzeitschriften wie „Nature“ zu einem klaren Schluss: Es gibt bis heute keine überzeugenden Beweise dafür, dass soziale Medien die Ursache für Körperbildstörungen sind (Rück, Christian, et al. "Body dysmorphic disorder." Nature Reviews Disease Primers 10.1 (2024): 92.).
Umso mehr Sorge macht mir, dass politische Berater hier oft nicht die nötige wissenschaftliche Sorgfalt zeigen. Ein Beispiel ist ein Bericht des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages aus dem Jahr 2024. Dort sieht es so aus, als hätte man gezielt nur die Studien herausgepickt, die zur vorgefassten Meinung „Social Media ist gefährlich“ passen. Die großen Schwächen dieser Studien wurden dabei unter den Tisch fallen gelassen. Hätte man so sauber gearbeitet wie die Experten im „Nature“-Artikel, hätte man zugeben müssen: Die Studienlage ist schwach und die wahre Ursache weiterhin unklar.
Wie wackelig diese Beweise oft sind, lässt sich gut an einer Studie zeigen, auf die sich die Politik gerne stützt. Dabei wurden gerade einmal 67 Psychologie-Studenten untersucht. Aus einer so kleinen Gruppe von Studenten auf die gesamte Bevölkerung zu schließen, ist schon sehr fragwürdig. Das Hauptproblem ist aber ein anderes: Diese Teilnehmer waren ja vom Fach. Psychologie-Studenten sind keine neutralen Testpersonen. Sie kennen die Theorien und wissen genau, was die Forscher vermuten. Wenn sie bei einer Studie zum Thema „Social Media und Essstörungen“ mitmachen und eine Woche lang auf Instagram und Co. verzichten sollen, durchschauen sie das Spiel sofort. Sie wissen: „Aha, der Verzicht soll mein Körperbild verbessern.“ Ob sie sich wirklich daran gehalten haben, wurde dabei kaum geprüft. Ein Screenshot vom Handy beweist wenig – man kann die App einfach löschen, um das Handy „sauber“ zu halten, und abends trotzdem stundenlang am Laptop durch die Feeds scrollen. Am Ende der Woche wurden sie dann gefragt, ob ihre Figur ihr Denken beeinflusst hat. Da die Studenten wussten, dass sie verzichtet haben – was ja durchaus anstrengend ist –, wollten sie unbewusst, dass sich der Aufwand auch gelohnt hat. Wer sich anstrengt, redet sich das Ergebnis oft schön, um die Mühe zu rechtfertigen. Die Messwerte lagen zudem vorher wie nachher im völlig normalen Bereich. Das beweist also keine Heilung einer Krankheit. Es zeigt nur, dass sich gesunde Studenten kurzzeitig besser fühlen, wenn sie glauben, dass sie sich besser fühlen sollen (Dondzilo, Laura u. a., A preliminary investigation of the causal role of social media use in eating disorder symptoms. In: Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, Band 82, Artikel Nr. 101923, März 2024).
Medien arbeiten zwangsläufig mit Auswahl: Sie zeigen nicht einfach den Alltag, sondern oft das Herausragende – Talent, Intelligenz, sportliche Leistung, Schönheit. Daraus unmittelbar ein Verbot abzuleiten, um mögliche negative Effekte auf das Selbstwertgefühl mancher Zuschauer zu vermeiden, widerspricht der Freiheit der Berichterstattung. Ebenso wenig ist es überzeugend, individuelle Bestrebungen nach Verbesserung – ob sportlich, intellektuell oder Attraktivität – pauschal moralisch zu problematisieren; in der Regel handelt es sich um eine autonome persönliche Entscheidung, die weder eine Abwertung anderer impliziert noch einen Anspruch begründet, dass alle diesem Maßstab folgen müssten.
Frühe Makeover-Shows wie «The Swan» setzten radikal auf operative „Optimierung“. Wie bewerten Sie rückblickend diese Form des Fernsehens aus medizinischer und psychologischer Sicht?
Als Arzt rate ich ganz pragmatisch: Gehen Sie lieber raus an die frische Luft und bewegen Sie sich, statt vor dem Fernseher zu sitzen. Für eine tiefere psychologische Analyse fehlt mir an der Stelle die Fachkompetenz. Aber als Attraktivitätsforscher und Plastischer Chirurg möchte ich Menschen das Wissen geben, um sich eine eigene Meinung zu bilden.
Begriffe wie „Optimierung“ oder „Schönheitsideal“ sind Schubladen, die uns den Blick auf die wahren Zusammenhänge versperren. Dabei ist der Wunsch nach Schönheit so alt wie die Menschheit selbst. Weltweit beschäftigen sich 99 Prozent aller Leute täglich mit ihrem Äußeren. Wir investieren im Schnitt vier Stunden am Tag in unsere Verschönerung – egal ob durch Pflege, Sport, Ernährung oder Styling. Das Wort „Optimierung“ unterstellt dabei fälschlicherweise, dass alle nach unerreichbarer Perfektion streben. Doch ob Lippenstift, Zahnspange oder das Entfernen einer Warze im Gesicht: Das Ziel ist fast nie, perfekt zu sein, sondern einfach attraktiver zu wirken. Wer das alles pauschal als Perfektionswahn verurteilt, spaltet die Diskussion. Man übersieht dabei völlig, dass es den meisten Menschen schlicht um Lebensqualität, Würde und den Wunsch geht, sich in der eigenen Haut wohlzufühlen.
Formate wie «The Swan» packen extrem viele Eingriffe zusammen, um einen möglichst drastischen Vorher-Nachher-Effekt zu erzielen. Das Fernsehen liebt solche Zuspitzungen und das Spiel mit extremen Gegensätzen, denn genau das bringt die Einschaltquoten. Dabei werden menschliche Schicksale oft regelrecht ausgeschlachtet. Mir fehlt an dieser Stelle nicht nur die Menschlichkeit, sondern auch die Sachlichkeit.
Eine Operation ist kein Zaubertrick: Sie hat Risiken und braucht Zeit zur Heilung. Das wurde in der Sendung verschwiegen. Was aber ebenso fehlte, ist die wissenschaftliche Wahrheit über den Nutzen: Wir wissen, dass echte körperliche Makel die Lebensqualität, das Selbstbewusstsein und sogar die sexuelle Zufriedenheit massiv einschränken können. Wenn eine Operation die Attraktivität steigert, verbessert sich genau dadurch nachweislich auch die Lebensqualität und das Selbstbewusstsein. Die Show hat also beides ignoriert: die echten Gefahren und die Tatsache, dass ein besseres Aussehen oft zu einem besseren Leben führt.
Auch Abnehmformate wie «The Biggest Loser» erzählen Erfolg fast ausschließlich über Gewichtsverlust. Was ist daran problematisch – jenseits der offensichtlichen Zahl auf der Waage?
Auch das Format «The Biggest Loser» lebt von der extremen Übertreibung. Die Menschen werden dort auf ihr Aussehen reduziert. Das ist problematisch. Aber genauso falsch ist das Gegenteil – also die Behauptung, dass Äußerlichkeiten völlig egal wären und nur die inneren Werte zählen.
Tatsache ist: Unser Gesicht und unser Körper verraten unheimlich viel über uns. Sie geben Auskunft über unser Alter, unser Geschlecht, unsere Gefühle, unsere Persönlichkeit und unseren Gesundheitszustand. Das alles beeinflusst blitzschnell und unbewusst, wie wir einander einschätzen. Wie sehr wir auf diese Signale angewiesen sind, hat uns die Pandemie gezeigt: Wenn durch die Maske nur noch die Augen zu sehen sind, wird die Verständigung ohne Worte extrem schwierig. Wir tun uns dann schwer, Gefühle richtig zu deuten oder sogar Menschen wiederzuerkennen.
Das Problem an solchen Formaten ist die fehlende Nachhaltigkeit. Wer nur für die Kameras und unter extremem Zeitdruck abnimmt, hält das Gewicht meist nicht. Echte Veränderung braucht innere Überzeugung, keinen Show-Effekt. Zudem tut die Sendung so, als wäre alles nur eine Frage der Willenskraft. Das ist unfair. Übergewicht und Depression bilden oft einen Teufelskreis: Wer zu viel wiegt, wird schneller depressiv – und wer depressiv ist, kümmert sich oft weniger um sich. Dazu kommt die Biologie: Wir wissen, dass Übergewicht zu etwa 30 bis 40 Prozent vererbbar ist. Aber das ist kein Grund zur Aufgabe. Im Gegenteil, das Glas ist mehr als halb voll: Den größten Teil haben wir immer noch selbst in der Hand. Ich sehe täglich Patienten, die es schaffen.
Was mich als Mediziner stört: Die Show macht aus einer ernsten Bedrohung Unterhaltung. Adipositas ist gefährlich. Schon ein leicht erhöhter BMI steigert das Sterberisiko um 18 Prozent. Fettleibigkeit begünstigt Diabetes, Herzleiden und viele Krebsarten. Wir steuern auf eine Welt zu, in der 2035 die Hälfte der Menschheit übergewichtig sein wird. Es gibt heute weltweit schon mehr fettleibige als untergewichtige Kinder. Das ist ein historischer Wendepunkt: Kinder werden heute krank durch falsches Essen, nicht durch Hunger.
Deshalb hilft uns weder eine Show, die Dicke vorführt, noch eine Body-Positivity-Bewegung, die die gesundheitlichen Gefahren ignoriert. Wir brauchen mehr Realismus und eine sachliche Debatte über diese medizinische Herausforderung.
Sie schreiben, dass Attraktivität häufig mit Gesundheit verwechselt wird. Wie sehr verstärken TV-Formate und Reality-Erzählungen diesen Trugschluss?
Man darf Attraktivität nicht einfach eins zu eins mit Gesundheit gleichsetzen. Aber umgekehrt gilt: Unattraktivität ist oft ein Hinweis auf Krankheit. Das kennen wir aus dem Alltag: Eltern sehen ihrem Kind oft sofort an, dass etwas nicht stimmt: „Du siehst heute aber nicht gut aus, wir messen mal Fieber“. Auch Ärzte kennen die sogenannte „Blickdiagnose“. Das heißt, ganz spezifische äußere Zeichen verraten eine bestimmte Krankheit. Merkmale wie Augenringe, gelbe Augen, schlechte Haut, Haarausfall, kaputte Zähne, Narben oder ein schiefes Gesicht mindern unsere Attraktivität, weil sie uns instinktiv weniger gesund erscheinen lassen. Unser Gehirn schaltet dann sofort in Alarmbereitschaft. Menschen mit sichtbaren Auffälligkeiten werden deshalb manchmal gemieden. Untersuchungen zeigen sogar etwas Faszinierendes: Unser Immunsystem reagiert sofort, wenn wir bei unserem Gegenüber Krankheitszeichen sehen. Man kann im Blut tatsächlich messen, dass unsere Abwehrkräfte hochfahren – nur weil wir jemanden anschauen, der krank wirkt.
Abwehrzellen erkennen gesunde und kranke Zellen. Ebenso wichtig ist es, dass der Mensch gesunde und kranke Mitmenschen unterscheiden kann. Wer Krankheiten meidet, schützt nicht nur sich selbst, sondern auch die Menschen um sich herum. So breiten sich Infektionen weniger schnell aus. Bis vor wenigen Jahrzehnten überlebten nur jene Menschen, die eine robuste Immunabwehr besaßen und sich durch ihre Verhaltensweisen vor Krankheiten schützen konnten. Dies diente dem Schutz des Individuums und der Gemeinschaft. Dass von Menschen mit einer Gesichtsnarbe oder eingefallenen Wangen nicht notwendigerweise eine Ansteckungsgefahr ausgeht, spielte in der Evolution eine untergeordnete Rolle.
Außerdem hat die Reaktion auf Anzeichen von Krankheiten Vorteile für eine gesunde Fortpflanzung. Wer selbst ein starkes Immunsystem besitzt, kann diese Eigenschaft an die eigenen Kinder weitergeben. Und wer sich einen gesunden Partner sucht, erhöht die Chance, gesunden Nachwuchs zu bekommen.
Gesundheit ist weit mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit – und Attraktivität ist weit mehr als nur die Abwesenheit von Unattraktivität. Nehmen wir das Alter als Beispiel: Natürlich kann man mit über 60 noch kerngesund sein. Aber man besitzt schlicht nicht mehr die Fruchtbarkeit und Vitalität, die man mit Mitte 20 hatte. Die Evolution hat es deshalb so eingerichtet, dass wir Menschen mit 60 nicht mehr als so anziehend empfinden wie mit 25 – selbst wenn sie völlig gesund sind.
Im Fernsehen beobachte ich oft eine ganz anderen Verwechslung: Dort wird echte Attraktivität ständig mit Mode verwechselt. Dinge wie Tattoos, Piercings oder extremere Trends wie gespaltene Zungen, Tellerlippen oder Giraffenhälse sind kulturelle Erfindungen. Sie zeigen, zu welcher Gruppe man gehört oder welchen Status man hat – mit biologischer Anziehungskraft hat das aber nichts zu tun. Echte körperliche Attraktivität ist zeitlos. Sie beruht auf festen Merkmalen wie Symmetrie, Jugendlichkeit, Durchschnittlichkeit und typisch männlichen oder weiblichen Merkmalen. Das ist keine Geschmacksfrage: Es gab noch nie eine Kultur oder Epoche, in der Menschen über 60 als körperlich anziehender empfunden wurden als Menschen mit Mitte 20.
Auf Plattformen wie TikTok dominieren Filter, Körpertrends und „Glow-Ups“. Welche Wirkung hat diese permanente visuelle Optimierung auf das gesellschaftliche Normalmaß von Schönheit?
Ein Blick in die Geschichte verrät uns viel: Glauben wir wirklich, die Büste der Nofretete zeigt die ungeschminkte Realität? Auch griechische Skulpturen oder die Porträts des Sonnenkönigs wurden schon damals schöner dargestellt, als die Personen in Wahrheit waren. Das setzt sich heute nahtlos fort. Fotos werden retuschiert, seit es Kameras gibt. Es gibt kaum ein Magazin-Cover, das nicht bearbeitet ist. Und wem Photoshop zu mühsam ist, der korrigiert Hautunregelmäßigkeiten eben vorher mit Make-up. Kein Kinofilm und keine Talkshow kommt ohne Maskenbildner aus. Da muss man sich fragen: Wenn Schönheit wirklich nur reine Geschmackssache wäre – warum machen wir das dann überall und schon seit Jahrtausenden? Und warum finden fast alle das bearbeitete Bild ansprechender? Die Antwort ist klar: Schöne Haut, schöne Haare und gesunde Zähne werden nicht erst als schön empfunden, seit es soziale Medien gibt. Das war in allen Kulturen so – und zwar schon immer.
Ich selbst nutze keine sozialen Medien und sehe sie sehr kritisch. Mein größtes Bedenken ist die Art der Kommunikation: Um Klicks zu generieren, wird dort alles vereinfacht, überspitzt und in Schwarz-Weiß gemalt. Für eine ausgewogene, sachliche Diskussion ist da kein Raum. Dazu kommen Inhalte, die mir große Sorgen bereiten, wie Gewalt oder Kinderpornografie. Unabhängig von diesen Schäden bin ich auch von den angeblichen Vorteilen nicht überzeugt. Meine Empfehlung ist daher simpel: Füllen Sie Ihre Freizeit so sehr mit echten Aktivitäten und realen Treffen mit Freunden, dass schlicht keine Zeit für Social Media bleibt.
Um das Social-Media-Verbot in Australien in diesem Kontext einzuordnen: Ich erwarte nicht, dass dadurch schöne Haut, gesunde Zähne oder volles Haar plötzlich an Bedeutung verlieren. Auch Attraktivität wird wichtig bleiben. Und ähnlich wie bei der Debatte um TV-Shows erwarte ich auch nicht, dass sich die Häufigkeit von Körperbildstörungen dadurch nennenswert verändert. Aber insgesamt ist weniger Bildschirmzeit natürlich absolut zu begrüßen.
Übrigens zeigen mehrere Studien, dass Warnhinweise auf Fotos kaum vor Körperbildstörungen schützen (McComb, S. E., et al. (2020). A systematic review on the effects of media disclaimers on young women’s body image and mood. Body image, 32, 34-52.) (Tiggemann, M., et al. (2014). ‘Retouch free’: The effect of labelling media images as not digitally altered on women's body dissatisfaction. Body image, 11(1), 85-88.) (Tiggemann, M. (2022). Digital modification and body image on social media: Disclaimer labels, captions, hashtags, and comments. Body image, 41, 172-180.). Ob da steht, dass ein Bild bearbeitet wurde, ändert an der Wirkung auf junge Frauen oft nichts. Für den Nutzen solcher Kennzeichnungspflichten, wie sie Norwegen seit 2022 und Frankreich seit 2017 eingeführt haben, gibt es bisher keinerlei wissenschaftliche Belege.
Zwischen Body-Positivity und Botox entsteht ein paradoxes Spannungsfeld. Sind wir heute wirklich freier im Umgang mit unserem Körper – oder nur subtiler fremdgesteuert?
Wir leben in einer Zeit, die körperliche Selbstbestimmung feiert wie nie zuvor – etwa bei geschlechtsangleichenden Maßnahmen. Wenn Menschen ihr Äußeres an ihr gefühltes Inneres anpassen, gilt das heute zu Recht als Ausdruck von Freiheit. Doch sobald es um klassische Schönheitschirurgie geht, kippt die Toleranz: Plötzlich gilt der Wunsch nach Veränderung nicht mehr als selbstbestimmt, sondern als fremdgesteuert oder Zeichen von Schwäche. Diesen Widerspruch kann ich nicht auflösen. Aber die Behauptung, wir hätten plötzlich eine „Pandemie des Schönheitswahns“, höre ich, soweit ich zurückdenken kann. Nüchtern betrachtet ist der Wunsch nach Schönheit und Jugendlichkeit so alt wie die Menschheit selbst. Ist das also ein „Wahn“?
Wer den „Schönheitswahn“ der Gesellschaft beklagt, ist oft gleichzeitig der Ansicht, Schönheit liege allein im Auge des Betrachters. Das ist ein direkter Widerspruch. Denn wäre Attraktivität wirklich völlig beliebig, würden Menschen nicht alle vergleichbare Dinge tun, um attraktiv zu wirken. Dass sich unsere Vorlieben über viele Epochen und Kulturen hinweg gleichen, zeigt ganz klar: Das ist kein Wahn. Es beweist vielmehr, dass Attraktivität kein Zufallsprodukt ist, sondern festen Regeln folgt, die man empirisch beschreiben kann. Und genau das ist der Grund, warum es die Attraktivitätsforschung überhaupt gibt.
Die Idee, dass sich Menschen aus einer spontanen Laune heraus operieren lassen, ist wissenschaftlich widerlegt. So etwas mag vielleicht auf Tattoos, Nasenringe oder eine Kurzhaarfrisur zutreffen. Aber Mode und physische Attraktivität sind zwei völlig verschiedene Dimensionen. Bei Brustoperationen besuchen Patientinnen im Schnitt zwei bis fünf Spezialisten und lassen sich durchschnittlich vier Jahre Zeit für ihre Entscheidung. Der Zugang zu Informationen ist dabei heute viel leichter. Vor 30 Jahren brauchte man einen Bibliotheksausweis, musste stundenlang in Regalen oder auf Mikrofiche suchen, und oft vergingen Wochen, bis ein Buch da war.
Dabei wird oft übersehen: Die Hürden für einen Eingriff sind hoch. Die ärztliche Aufklärungspflicht ist in der Plastischen Chirurgie umfassender als in fast jedem anderen medizinischen Bereich, und die gesetzlichen Standards in Deutschland setzen weltweit Maßstäbe. Das schützt vor Übereilung.
Einerseits wird Selbstoptimierung in der Gesellschaft gefordert. Sobald Menschen dies jedoch mittels Chirurgie tun, werden sie oft als „oberflächlich“, „unsicher“ oder „narzisstisch“ stigmatisiert. Anstatt Patienten also pauschal zu pathologisieren oder medial zu stigmatisieren, sollten wir ihre Entscheidungen respektieren. Es gibt keinen Grund für Alarmismus – wohl aber für eine sachliche Debatte, die die Mündigkeit des Patienten in den Mittelpunkt stellt, statt ihn zu bevormunden.
Die neue Abnehmspritze verspricht schnellen Erfolg – vor allem für jene, die sie sich leisten können. Entsteht hier eine neue soziale Spaltung von Körpern: schlank durch Geld, „diszipliniert“ durch Verzicht?
Die Abnehmspritze, wie etwa Ozempic, wurde weltweit extrem streng geprüft. Sie ist in Europa, den USA und vielen anderen Ländern zugelassen – und zwar aus gutem Grund: Wirksamkeit und Sicherheit haben in allen Tests überzeugt. Natürlich gibt es Missbrauch, und den verurteile ich ganz klar. Aber man darf nicht vergessen: Forschung und solche strengen Tests kosten enorm viel Geld. Deshalb ist die Spritze teuer, genau wie andere innovative Medikamente auch.
Wenn diese Spritze nun auf Kassenkosten verschrieben wird, zahlt das die Allgemeinheit. Wir merken ja alle, dass die Beiträge unaufhörlich steigen. Deshalb müssen wir dringend eine gesellschaftspolitische Debatte führen: Was muss der Einzelne tragen, und was übernimmt die Solidargemeinschaft?
Wissenschaftliche Fakten können uns hier Orientierung geben. Eine wichtige Studie aus dem Jahr 2022 im renommierten Fachblatt „The Lancet“ zeigt ganz klar: Wenn wir mehr Eigenverantwortung für unseren Körper übernehmen würden, wäre fast die Hälfte aller Krebstodesfälle weltweit vermeidbar. Die Hauptursachen sind bekannt: Rauchen, Alkohol und ungesunde Ernährung. Nüchtern betrachtet liegt hier ein gigantisches Einsparpotential für unser Gesundheitssystem.
Wir sollten Diskussionen über Behandlungsmethoden oder Attraktivitätsforschung absolut nüchtern führen, ohne politisches Framing. Für echte wissenschaftliche Klarheit müssen wir die fachliche Ebene sauber von der politischen Einordnung trennen.
In TV-Erzählungen wird Abnehmen oft als persönliche Leistung inszeniert. Welche strukturellen Faktoren – Stress, Arbeit, Armut, psychische Belastung – werden dabei systematisch ausgeblendet?
Natürlich blenden solche TV-Formate oft Stress, finanzielle Sorgen oder psychische Belastungen aus. Aber als Arzt sehe ich eine große Gefahr darin, diese strukturellen Faktoren als Entschuldigung vorzuschieben. Wer dem Patienten sagt „Du kannst nichts dafür, die Umstände sind schuld“, nimmt ihm die Macht über den eigenen Körper.
Wie bereits erwähnt: Wir wissen, dass Übergewicht zu etwa 30 bis 40 Prozent vererbbar ist. Das heißt aber im Umkehrschluss: Den größten Teil – also 60 bis 70 Prozent – haben wir immer noch selbst in der Hand.
Aus meiner Sicht ist es daher viel hilfreicher, den Menschen die Augen dafür zu öffnen, was sie selbst tun können. Diese Selbstermächtigung wirkt nämlich weit über die bloße Figur hinaus, sie entscheidet über Leben und Tod. Das ist wissenschaftlich belegt: Die bereits erwähnte große Studie im Fachblatt ‚The Lancet‘ (2022) zeigt eindrucksvoll, dass fast die Hälfte aller weltweiten Krebstodesfälle auf vermeidbare Risikofaktoren zurückgeht – allen voran Rauchen, Alkohol und ein hoher BMI. Das beweist: Wir sind nicht einfach Opfer unserer Gene oder unserer Lebensumstände. Eigenverantwortung ist der stärkste Hebel für unsere Gesundheit, den wir besitzen.
Das gilt nicht nur für die Vorbeugung, sondern insbesondere auch bei der Behandlung. Selbst nach einer Krebsdiagnose hat die eigene Haltung – im Sinne von echter Selbstermächtigung und aktivem Handeln – einen messbaren Einfluss auf das Überleben.
Damit wir uns nicht falsch verstehen: Es geht nicht um positives Denken als Esoterik, also das bloße „Wegwünschen“ von Krebs. Es geht um die aktive Teilnahme an der Genesung. Eine der hierfür bedeutendsten Fachzeitschrift der Welt, veröffentlichte dahingehend Richtlinien für Krebspatienten. Die Datenlage ist eindeutig: Patienten, die nach der Diagnose ihren Lebensstil aktiv verbessern – also Ernährung anpassen, sich bewegen und das Körpergewicht optimieren –, senken ihr Risiko, an dem Krebs zu sterben, signifikant (Rock, C. L., et al. (2022). American Cancer Society nutrition and physical activity guideline for cancer survivors. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 72(5), 430-462.).
Wer sich selbst ermächtigt und aktiv mitarbeitet, verbessert seine Prognose drastisch. Die positive Botschaft: Wir sind Krankheiten nicht hilflos ausgeliefert!
Sie betonen, dass Attraktivität viel mit Durchschnitt, Symmetrie und Gesundheit zu tun hat. Warum dominieren in Medien dennoch extreme Körperbilder statt realistische Vielfalt?
Die Medien leben von Sensationalismus! Wenn über Schönheitschirurgie berichtet wird, sehen wir deshalb oft die „Botox-Opfer“ oder prominente Exzesse. Die wirklich guten Ergebnisse nehmen wir als solche gar nicht wahr. Und hier müssen wir mit einem Missverständnis aufräumen: Ein „natürliches Ergebnis“ bedeutet nicht, dass nichts gemacht wurde. Im Gegenteil: Die Attraktivität ist deutlich gesteigert, aber es wirkt eben natürlich.
Nehmen Sie als Beispiel eine Zahnspange: Wenn die Behandlung abgeschlossen ist, sehen die Zähne symmetrisch und gesund aus. Das Lächeln ist viel attraktiver als vorher. Aber niemand sieht diesem Lächeln an, dass es das Ergebnis einer medizinischen Behandlung ist. Man sieht nur die Schönheit, nicht den Eingriff. Und genau das ist das Problem der Berichterstattung: Wie soll ein Journalist über gelungene Zahnbehandlungen von Prominenten berichten, wenn er sie im Alltag gar nicht als solche erkennt?
Aber schauen wir mal abseits dieser Skandale: Wer moderiert die Sendungen, wer spielt die Hauptrollen, wer füllt die größten Konzerthallen? Das sind überwiegend Menschen, die alle objektiven Attraktivitätskriterien erfüllen: Sie sind jung, haben symmetrische Gesichter, gesunde Proportionen, reine Haut, volles Haar und schöne Zähne.
Warum ist das so? Ganz einfach: Unser Gehirn ist darauf programmiert. Allein der Anblick eines attraktiven Menschen aktiviert unser Belohnungszentrum und schüttet Dopamin aus – genau wie beim Essen von Schokolade. Schönheit ist für unser Gehirn das Signal: „Das hier ist angenehm.“ Gutaussehende Menschen machen ihr Umfeld also, biochemisch gesehen, glücklicher.
Dazu kommt der psychologische Effekt: Wir fühlen mit schönen Menschen stärker mit. Wir lachen öfter über ihre Witze. Wir erkennen in ihren Gesichtern schneller Freude, selbst wenn sie neutral schauen. Das erklärt, warum sie nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Politiker, Musiker oder Sportler erfolgreicher sind. Sie wirken überzeugender und bleiben uns besser im Gedächtnis.
Wichtig ist mir dabei eine Differenzierung: „Attraktiv“ heißt in diesem Kontext nicht, dass jeder wie ein retuschiertes Supermodel aussehen muss. Es bedeutet lediglich: Man liegt etwas über dem Durchschnitt der jeweiligen Branche. Und wir müssen mit einem weiteren Vorurteil aufräumen: Dass Schönheit angeblich Diversität ausschließt. Das ist ein Trugschluss. Warum sollten Menschen mit symmetrischen Gesichtern weniger vielfältig sein? Führt Attraktivität wirklich zur Gleichschaltung? Oder anders gefragt: Verliert ein Mensch an seiner Individualität, nur weil er sich eine störende Warze im Gesicht entfernen lässt? Wohl kaum.
Welche Verantwortung tragen Sender, Streamingplattformen und Social-Media-Algorithmen, wenn sie immer wieder dieselben idealisierten Körper belohnen und sichtbar machen?
Im Klartext sind Sender, Streamingplattformen und Social-Media-Algorithmen die Ursache für vermindertes Selbstwertgefühlt und Körperbildstörungen?
Die Ursachen sind hochkomplex und oft noch unverstanden. Wer behauptet, soziale Medien seien der klare Auslöser, ignoriert schlicht den aktuellen wissenschaftlichen Stand. Das bestätigt auch die Übersichtsarbeit von Rück et al. (2024) in Nature Reviews Disease Primers.
Aus meiner langjährigen Forschung weiß ich: Menschen suchen gerade bei komplexen Themen nach einfachen Antworten. Vor 40 Jahren waren die klassischen Medien schuld – das Internet gab es noch nicht. Dann war es die Schönheitsindustrie. Seit 15 Jahren sind es die sozialen Medien, und neuerdings soll die KI der Sündenbock sein.
Diese Sichtweise ist bequem. Sie entlastet uns und die Gesellschaft von jeder Verantwortung. Es herrscht dieser breite Konsens, dass eine „böse Macht“ uns unerreichbare Ideale aufzwingt. Das erlaubt uns, ganz leicht in die Opferrolle zu schlüpfen und so zu tun, als hätten wir selbst mit diesen „Idealen“ rein gar nichts zu tun.
Dabei liegt es in der Natur der Medien, das Außergewöhnliche zu zeigen – ob Schönheit, Talent oder Stärke. Welche Quote hätte wohl ein Spiel der Kreisliga? Wir schauen Bundesliga, weil wir Spitzenleistung sehen wollen. Aber leidet das Selbstwertgefühl eines Hobbykickers, wenn er Profis sieht? Mir kommen ja auch Zweifel, wenn ich bei «Wer wird Millionär?» an den ersten drei Fragen scheitere. Aber hoffentlich bin ich nicht der Einzige – und hoffentlich wird die Sendung deswegen nicht verboten!
Frauen, die sich operieren lassen, tun das nicht, um ein Laufsteg-Model zu werden. Und sie tun es auch nicht, weil sie am Abend vorher «Germany’s Next Topmodel» gesehen haben. Ausnahmen bestätigen hier nur die Regel. Aber weil diese Ausnahmen das Klischee bedienen, werden sie immer wieder hervorgeholt. Wahrer wird die Geschichte dadurch aber nicht.
Wenn Sie ein neues TV-Konzept entwerfen dürften: Wie müsste eine zeitgemäße Sendung über Körper, Schönheit oder Gesundheit aussehen, die nicht normiert, beschämt oder vereinfacht – sondern aufklärt und entlastet?
Ich dachte eigentlich, mit diesem Buch hätte ich meinen Beitrag zur Versachlichung der Debatte erst einmal geleistet. Der Ausflug in die Autorenwelt war schon ein großes Abenteuer für mich. Jetzt auch noch das Handwerk eines TV-Produzenten zu lernen – das überlasse ich dann doch lieber den Profis.
Mit meinem Beruf als Arzt, Wissenschaftler und Dozent bin ich voll und ganz ausgefüllt, und von der Arbeit am Buch muss ich mich erst einmal erholen. Aber wer weiß: Wenn irgendwann mal das Fernsehen ruft, vielleicht schlummert ja doch ein Harald Lesch in mir!
Vielen Dank für Ihre Zeit!
Das Sachbuch "Wunderschön: Warum wir dem Bann des Äußeren nicht entkommen. Sachbuch mit fundierten Einblicken in die Mechanismen von Attraktivität, Selbstbild und gesellschaftlichen Schönheitsidealen" kann unter anderem bei Amazon erworben werden.










 RTL bestätigt: Wontorra für Swarovski bei «Let's Dance»
RTL bestätigt: Wontorra für Swarovski bei «Let's Dance»  Quotencheck: «WaPo Bodensee»
Quotencheck: «WaPo Bodensee»









 Mediengestalter Bild & Ton / 2nd Broadcast Operator (m/w/d)
Mediengestalter Bild & Ton / 2nd Broadcast Operator (m/w/d) Redaktionsleitung (m/w/d) im Bereich Factual Entertainment / Reality am Standort Ismaning bei München oder Köln in befristeter Anstellung
Redaktionsleitung (m/w/d) im Bereich Factual Entertainment / Reality am Standort Ismaning bei München oder Köln in befristeter Anstellung

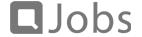

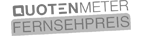
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel