Es ist die Geschichte einer Frau, die Mutter wird und die nicht wie von allen erwartet die Mutterschaft als persönliche Erfüllung empfindet, sondern im Gegenteil: Sie findet sich in einem neuen Zustand wieder und muss sich und ihrer Identität neu zusammenstellen. Ich wollte ihren Zustand ungeschönt erzählen, zeigen wie es ist. Ich bin vor allem überrascht, dass so eine Geschichte heutzutage als Tabubruch bezeichnet wird.
Wie viel persönlicher Erfahrungsstoff steckt in der Geschichte einer Frau, die sich nach der Geburt fremd fühlt?
In diese Geschichte sind viele meiner eigenen Erfahrungen eingewebt, aber es hat sich daraus eine völlig andere Geschichte entwickelt. Und es sind Ereignisse aus meinem Umfeld mit hinein geflossen, Erlebnisse von Freundinnen und Bekannte rund um ihre Geburt. Viele Sätze wurden tatsächlich gesagt. Viele Figuren aus der Geschichte haben reale Vorbilder, manche Orte gibt es tatsächlich, anderes ist dafür völlig fiktiv.
Der Film bewegt sich zwischen Psychodrama und Thriller. Welche Tonalität stand für Sie im Vordergrund?
Die Geschichte folgt ihrer eigenen Tonalität und steuert auf einen Höhepunkt zu. Ich habe da nichts bevorzugt, sondern bin der inneren Logik der Geschichte gefolgt. Das subtile Unwohlsein, das diesen Film begleitet, ist auch im Tonstudio entstanden. Mein Sounddesigner Nils Kirchhoff und ich haben die Musik von Diego Ramos Rodrígueuz in ihre einzelne Tonspuren zerlegt und sehr unterschwellig in die jeweilige Szene eingewebt. Gewisse Einstellungen wie die Bäume im Park in Kombination mit der Musik geben der Hauptfigur diese Verlorenheit, nach der wir gesucht haben.
Was hat Marie Leuenberger zur perfekten Besetzung für diese emotional extrem fordernde Hauptrolle gemacht?
Marie Leuenberger verkörpert eine Zerbrechlichkeit und Stärke in einer Person, sozusagen zwei komplette Gegensätze. Sie kann so kraftvoll sein und gleichzeitig so fragil, das war genau das, was ich mir für Julia vorgestellt habe. Sie hat sich total auf die Rolle eingelassen und trägt dadurch diesen Film.
Die Klinik wirkt zugleich verheißungsvoll und bedrohlich. Wie haben Sie diese Ambivalenz entwickelt?
Entscheidend dafür war die Ausstattung, die auf Eleganz setzt und uns etwas verspricht oder verkauft, ähnlich wie reale Privatkliniken ein Versprechen abgeben, dass man bei ihnen gut aufgehoben ist und geheilt wird. Ich glaube auch, dass Claes Bang und Julia Franz Richter dieser Klinik einen gewissen Glanz und etwas verführerisches geben, wir wollen ihnen so gerne vertrauen, uns in ihrer Arme legen und daran glauben, dass alles gut ist.
Welche gesellschaftlichen Erwartungen an Mütter wollten Sie unbedingt sichtbar machen?
Ich wollte und will erzählen, dass es sehr viele unterschiedliche Gefühlszustände als Mutter gibt. Nicht nur dieses eine perfekte Mutterbild, das von der Gesellschaft so propagiert wird. Ich wolle Julia als Mensch erzählen, die sich mit diesem Drüberstülpen der Mutterrolle schwer tut. Die sich fragt: was darin bin ich und warum tue ich mir schwer, diese Rolle überhaupt anzunehmen, was erwartet die Gesellschaft von mir und hat sie davon, dass ich darin reibungslos funktioniere.
Der Film lief im Berlinale-Wettbewerb. Was bedeutet Ihnen diese internationale Anerkennung?
Ich empfinde es wie alle KünstlerInnen als sehr wertschätzend, wenn die eigene Arbeit gesehen wird. Und ich habe mit diesem Film erfahren, um wieviel mehr Aufmerksamkeit eine Arbeit bekommt, wenn der Film bei einem A-Festival im Wettbewerb läuft. Und diese Form der Aufmerksamkeit ist natürlich das, was wir uns alle für unsre Filme wünschen.
Wie wichtig war die Zusammenarbeit mit Ihrem Kameramann Robert Oberrainer für die subjektive Bildsprache?
Robert Oberrainer und ich haben gemeinsam auf der Filmakademie Wien studiert und fast alle meine Filme gemeinsam gedreht. Wir sind uns freundschaftlich sehr verbunden, Robert kennt sowohl meine persönliche Geschichte als auch meinen visuellen Anspruch. Bei «Mothers Baby» haben wir gemeinsam mit Hannes Salat, unseren Szenenbildner, an der optischen Umsetzung gefeilt. Wir wollten einen körnigen Look erzählen, nahe am Filmmaterial Super16, auf dem wir ursprünglich gerne gedreht hätten. Wir haben mit Optiken gearbeitet, um Julias Gefühlt von Entfremdung und Einsamkeit zu verstärken. Wir haben Locations ausgewählt, die diesen Zustand verstärken. Sie fühlt sich mehr und mehr wie ein Alien, kann an ihrer Umgebung nicht mehr andocken.
Inwiefern fügt sich «Mother’s Baby» in Ihre bisherigen Arbeiten ein – oder markiert er einen neuen Weg?
«Mothers Baby» ist wie meine anderen Kinofilme eine Arbeit über persönliche Erfahrungen und Fragen zum Leben. Welche Erwartungen hat man, wie scheitert man mit seinen eigenen Erwartungen, wie kann man sich darin neu erfinden. Somit fügt er sich in meine bisherigen Arbeiten ein, obwohl «Mothers Baby» einen anderen Tonfall hat als die Filme davor.
Was soll das Publikum nach dem Abspann unbedingt mitnehmen oder hinterfragen?
Meine bisherige Erfahrung war, dass sich das Publikum, egal ob männlich oder weiblich, mit der eigenen Lebenserfahrung auseinandergesetzt hat. Es gibt ein großes Redebedürfnis. Es werden Themen besprochen, die lange im Verborgenen lagen, schmerzhafte Erfahrungen, die die meisten nur mit sich alleine oder als Paar ausgemacht haben. Die man nach der Geburt des eigenen Kindes in einen hinteren Winkel geschoben hat und am liebsten nie wieder damit berührt werden wollte. Aber ich empfinde dieses Mitteilen, das Darüber reden können als einen heilsamen Prozess.
Vielen Dank für unser Gespräch!
«Mothers Baby» startet am Donnerstag, den 15. Januar, in den deutschen Kinos










 Lesch und Cerne: Ungelöste Fälle im Februar
Lesch und Cerne: Ungelöste Fälle im Februar  ZDF beleuchtet «Putins Schattenkrieger»
ZDF beleuchtet «Putins Schattenkrieger» 








 Senior Video Producer/ 1st TV Operator (m/w/d)
Senior Video Producer/ 1st TV Operator (m/w/d) 1. Aufnahmeleitung im Bereich Reality (m/w/d)
1. Aufnahmeleitung im Bereich Reality (m/w/d) Initiativbewerbungen (m/w/d)
Initiativbewerbungen (m/w/d)

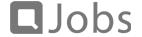

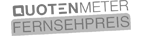
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel