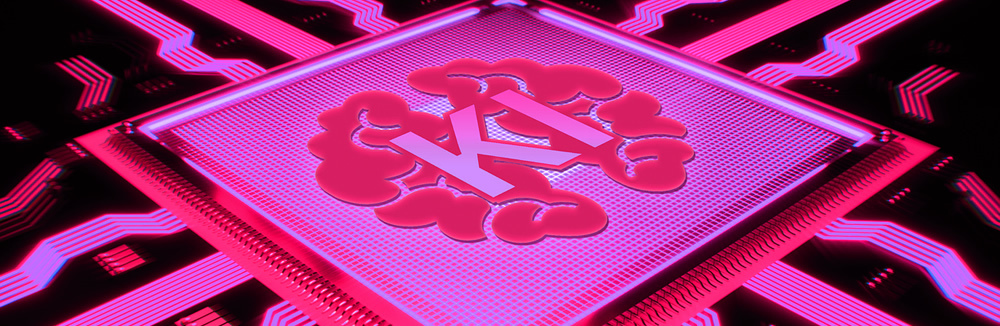
SchwerpunktDie Macht der KI: Wie sie die Welt und auch die Medien verändert
Künstliche Intelligenz ist längst keine Science-Fiction mehr, sondern verändert bereits jetzt unter anderem die Medien – mit ungeahnten Chancen und Risiken für die Zukunft.
 Künstliche Intelligenz – oder kurz KI – ist seit Ende 2022 in den Schlagzeilen wie nie zuvor. Was noch vor wenigen Jahren als futuristische Technologie galt, hat sich mittlerweile zu einem prägenden Element in vielen Bereichen des täglichen Lebens entwickelt, insbesondere in den Medien. Mit der rasanten Weiterentwicklung von KI-Systemen, die in der Lage sind, Texte zu schreiben, Bilder zu generieren und sogar ganze Filme zu produzieren, stellt sich nur die Frage, was diese Technologie leisten kann, sondern auch, wie sie die Medienlandschaft langfristig verändern wird. Doch trotz der Faszination, die sie auslöst, gibt es auch eine Vielzahl von Herausforderungen und Risiken, die es zu bedenken gilt – von der Verbreitung von Deepfakes bis hin zu ethischen Fragestellungen. Dieser Artikel beleuchtet die vielen Facetten der KI in den Medien und gibt einen Ausblick darauf, was uns in der Zukunft erwarten könnte.
Künstliche Intelligenz – oder kurz KI – ist seit Ende 2022 in den Schlagzeilen wie nie zuvor. Was noch vor wenigen Jahren als futuristische Technologie galt, hat sich mittlerweile zu einem prägenden Element in vielen Bereichen des täglichen Lebens entwickelt, insbesondere in den Medien. Mit der rasanten Weiterentwicklung von KI-Systemen, die in der Lage sind, Texte zu schreiben, Bilder zu generieren und sogar ganze Filme zu produzieren, stellt sich nur die Frage, was diese Technologie leisten kann, sondern auch, wie sie die Medienlandschaft langfristig verändern wird. Doch trotz der Faszination, die sie auslöst, gibt es auch eine Vielzahl von Herausforderungen und Risiken, die es zu bedenken gilt – von der Verbreitung von Deepfakes bis hin zu ethischen Fragestellungen. Dieser Artikel beleuchtet die vielen Facetten der KI in den Medien und gibt einen Ausblick darauf, was uns in der Zukunft erwarten könnte.Was ist KI und was kann sie?
Was eine KI ist und was sie kann, kann man zwar grundlegend erklären, jedoch entwickelt sich dies auch stetig weiter und verändert sich. Derzeit kann man die KI so erklären, dass sie die Fähigkeit hat, menschenähnliche Aufgaben zu übernehmen, die normalerweise Intelligenz erfordern – wie Denken, Lernen, Problemlösen oder Wahrnehmung. Sie basiert auf komplexen Algorithmen und Datenmodellen, die es Computern ermöglichen, Informationen zu verarbeiten, Muster zu erkennen und auf dieser Grundlage Entscheidungen zu treffen, ohne explizit dafür programmiert worden zu sein. Kurz gesagt: KI ist die Fähigkeit von Maschinen, eigenständig zu „lernen“ und sich an neue Gegebenheiten anzupassen.
Künstliche Intelligenz kann in verschiedene Typen unterteilt werden, die jeweils unterschiedliche Fähigkeiten und Anwendungsbereiche umfassen. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen der sogenannten „schwachen KI“ und der „starken KI“. Schwache KI, auch als enge KI bezeichnet, ist auf die Lösung spezifischer Aufgaben ausgerichtet. Sie wird gezielt für bestimmte Funktionen entwickelt und trainiert. Beispiele für schwache KI sind Industrieroboter oder digitale Assistenten wie Siri von Apple. Im Gegensatz dazu beschreibt starke KI, auch als künstliche allgemeine Intelligenz (AGI) bekannt, ein System, das in der Lage ist, die kognitiven Fähigkeiten des menschlichen Gehirns zu imitieren. Ein starkes KI-System könnte in der Lage sein, auf neue, unbekannte Aufgaben mit Lösungen zu reagieren, indem es Wissen von einem Bereich auf einen anderen überträgt. Theoretisch könnte diese Form von KI sowohl den Turing-Test als auch den chinesischen Zimmer-Test bestehen.
Zusätzlich zur Unterscheidung zwischen schwacher und starker KI existiert eine weitere Kategorisierung, die von Arend Hintze, einem Assistenzprofessor für integrative Biologie und Computerwissenschaft an der Michigan State University, in einem Artikel aus dem Jahr 2016 vorgestellt wurde. Er unterscheidet insgesamt vier Typen von KI, die von heutigen aufgabenspezifischen Systemen bis hin zu noch nicht existierenden empfindungsfähigen Systemen reichen:
- Typ 1: Reaktive Maschinen (Reactive Maschines): Diese KI-Systeme sind auf eine spezifische Aufgabe fokussiert und haben kein Gedächtnis. Sie können lediglich aktuelle Eingaben verarbeiten, ohne auf frühere Erfahrungen zurückzugreifen. Ein bekanntes Beispiel ist Deep Blue, das Schachprogramm von IBM, das 1997 den Schachweltmeister Garri Kasparow besiegte. Deep Blue kann die Stellung auf dem Schachbrett erkennen und darauf basierend Entscheidungen treffen, ist jedoch nicht in der Lage, seine Vergangenheit zu speichern oder sie für zukünftige Züge zu nutzen.
- Typ 2: Begrenztes Gedächtnis (Limited Memory): Im Gegensatz zu reaktiven Maschinen verfügen diese KI-Systeme über ein Gedächtnis und können somit aus vergangenen Erfahrungen lernen, um ihre zukünftigen Handlungen zu verbessern. Ein Beispiel hierfür sind die Entscheidungsprozesse in selbstfahrenden Autos, die auf ehemalige Daten basieren, um Verkehrssituationen zu bewältigen.
- Typ 3: Theorie des Geistes (Theory of Mind): Dieser Begriff stammt aus der Psychologie und bezieht sich auf die Fähigkeit, Emotionen und soziale Signale zu erkennen sowie menschliche Absichten und Verhalten zu verstehen. Übertragen auf die KI bedeutet dies, dass diese Systeme in der Lage wären, die sozialen und emotionalen Zustände von Menschen zu erfassen und entsprechend zu reagieren. Ein solches KI-System könnte in der Zukunft in der Lage sein, nahtlos mit Menschen zu interagieren und sogar Teil eines Teams zu werden.
- Typ 4: Selbstwahrnehmung: Der höchste Entwicklungsstand der KI wäre ein System, das sich seiner eigenen Existenz bewusst ist. Diese Maschinen würden in der Lage sein, ihren eigenen Zustand zu erkennen und zu verstehen, wie sie sich in verschiedenen Situationen befinden. Eine solche KI, die über Selbstbewusstsein verfügt, existiert bisher jedoch noch nicht.

Die Geschichte hinter der KI
Selbst wenn die KI erst seit noch nicht so langer Zeit im Munde der Bevölkerung ist, hat die Geschichte schon in der Mitte des 20. Jahrhunderts begonnen und seitdem kamen immer wieder neue Meilensteine dazu, sodass die KI soweit fortgeschritten ist, wie wir sie heute kennen:
- 1950 – Turing-Test: Der Mathematiker Alan Turing formuliert den Turing-Test in seinem berühmten wegweisenden Aufsatz „Computing Machinery and Intelligence“, um zu testen, ob Maschinen „denken“ können.
- 1956 – Geburtsstunde der KI: Der Begriff der Künstlichen Intelligenz wurde von John McCarthy auf der von ihm organisierten Konferenz am Dartmouth College geprägt. Obwohl keine neuen Durchbrüche erzielt wurden, hat diese Konferenz beigetragen, die KI als eigenständiges Forschungsfeld zu etablieren und viele der teilnehmenden Forscher beeinflussten im Anschluss das Feld nachhaltig.
- 1958 – Das Perzeptron: Der Psychologe Frank Rosenblatt entwickelte ein lernfähiges künstliches Neuron, dieses künstliche neuronale Netz schuf die Grundlagen für die Verfahren des maschinellen Lernens, auf denen die heutigen Erfolge moderner KI-Systeme beruhen.
- 1959 – definierung: Arthur Samuel definiert „maschinelles Lernen“ als das Feld, das Computern die Fähigkeit gibt, zu lernen, ohne explizit programmiert zu werden.
- 1966 – Der erste Chatbot: Ein Programm namens ELIZA wird entwickelt, das natürliche Sprache verarbeiten kann und in der Lage ist, Konversationen zu führen.
- Frühe 1970er – 1. KI-Winter: Das Interesse an der künstlichen Intelligenz nahm stark ab und viele Forschungsgebiete auf diesem Gebiet wurden eingestellt, da u.a. die ausbleibenden Erfolge zu Enttäuschungen führten.
- 1970er – Expertensysteme: Der erste KI-Winter wurde durch die Entwicklung von Expertensystemen beendet. Expertensysteme sind Computerprogramme, mit denen das Spezialwissen menschlicher Experten über ein bestimmtes Sachgebiet sowie deren Schlussfolgerungsfähigkeiten nachgebildet werden. So werden Expertensysteme zum Beispiel in der Onkologie angewendet, um Ärzte und Pflegepersonal bei der Diagnose oder der Therapie von Krebspatienten zu unterstützen.
- 1980er – KI kann nachahmen und 2. KI-Winter: 1980 erschuf Edward Feigenbaum Expertensysteme, die Entscheidungen von menschlichen Experten nachahmen können. Später scheiterte jedoch das „Computerprojekt der 5. Generation“ von Japan, welches die technischen Beschränkungen herkömmlicher Computer überwinden sollte. Dies führte durch die zu ehrgeizigen Ziele und unrealistisch hohen Erwartungen, zu einer Ernüchterung gegenüber Expertensystemen und so zu einem zweiten KI-Winter.
- 1986 – „NETtalk“ spricht: Der Computer erhält erstmals eine Stimme. Durch die Eingabe von Beispielsätzen und Phonemketten bringen Terrence J. Sejnowski und Charles Rosenberg ihrem Programm „NETtalk“ das Sprechen bei. Es kann Wörter lesen und korrekt aussprechen sowie das Gelernte auf ihm unbekannte Wörter anwenden.
- 1997 – Computer schlägt Schachweltmeister: Die KI-Schachmaschine „Deep Blue“ der Firma IBM bezwingt den amtierenden Schachweltmeister Garry Kasparov in einem Turnier. Dies gilt als historischer Erfolg der Maschinen in einem Bereich, der bislang vom Menschen dominiert wurde. Kritiker werfen jedoch ein, dass „Deep Blue“ nicht durch kognitive Intelligenz, sondern nur durch das Berechnen aller denkbaren Züge gewonnen habe.
- 2011 – KI erreicht den Alltag: Technologiesprünge bei der Hard- und Software bahnen KI den Weg in das tägliche Leben. Leistungsstarke Prozessoren und Grafikkarten in Computern, Smartphones und Tablets ermöglichen es normalen Verbrauchern auf KI-Programme zuzugreifen. Insbesondere Sprachassistenten erfreuen sich großer Beliebtheit: Apples „Siri“ kommt 2011 auf den Markt, 2014 stellt Microsoft die Software „Cortana“ vor und Amazon präsentiert 2015 Amazon Echo mit dem Sprachdienst „Alexa“.
- 2011 – KI „Watson“ gewinnt Quizshow: Das Computerprogramm tritt in Form eines animierten Bildschirmsymbols in einer US-amerikanischen TV-Quizshow an und gewinnt gegen die menschlichen Mitspieler. Damit beweist „Watson“, dass es die natürliche Sprache versteht und schnell auf schwierige Fragen antworten kann.
- 2018 – KI debattiert über Raumfahrt und vereinbart einen Friseurtermin: Diese beiden Beispiele demonstrieren die Leistungsfähigkeit von KI: Im Juni liefert sich „Project Debater“ von IBM mit zwei Debattiermeistern ein Rededuell über komplexe Themen – und schneidet dabei beachtlich ab. Wenige Woche zuvor demonstriert Google auf einer Konferenz, wie die KI „Duplex“ beim Friseur anruft und im Plauderton einen Termin vereinbart – ohne dass die Dame am anderen Ende der Leitung merkt, dass sie mit einer Maschine spricht.
- Frühe 2020s – KI-Frühling: Seit dem sind die rasanten Entwicklungen auf dem Feld der KI in den Medien präsent. Insbesondere generative KI-Systeme versetzen die Menschen in Erstaunen. Diese können nicht nur Routineaufgaben erledigen sondern auch sehr kreativ sein, z.B. „ChatGPT“. Da diese Systeme zudem für eine breite Öffentlichkeit kostenfrei zugänglich gemacht wurden, lösten sie einen wahren KI-Boom aus.
Trotzdessen, dass die Geschichte der Künstlichen Intelligenz bereits 1950 begann, steht sie noch relativ am Anfang der Entwicklung. Das merkt man auch unter anderem an den KI-Wintern, wie Amara’s Law wiederspiegelt: „Kurzfristig überschätzen wir die Auswirkungen von Technologie, aber langfristig unterschätzen wir sie“. Kurzfristig wurden die Ausmaße immer wieder überschätzt und führte so zu Enttäuschungen, da nicht sofort alles so funktionierte und alles konnte wie zuvor gedacht, doch langfristig ist noch so viel möglich, besonders bei der KI, man kann sich noch gar nicht alle Möglichkeiten vorstellen uns so steht vor uns noch eine große Geschichte der Künstlichen Intelligenz, welche wir vielleicht auch gar nicht mehr mit erleben werden.
Die Reihe wird zeitnah fortgesetzt.