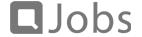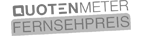Es mag einem möglicherweise nicht bewusst sein, aber noch bevor sich Spider-Man von Netz zu Netz durch New York schwang, und bevor Christian Bale als Batman den von schweren Gedanken geplagten Kopf hängen ließ, starteten Marvel und 20th Century Fox mit der Mutantentruppe «X-Men» den heutigen Superheldentrend. 2000 gehörte «X-Men» mit über 330 Millionen Dollar weltweitem Einspiel zu den erfolgreichsten Produktionen des Jahres. Hugh Jackman erlangte Weltruhm und Regisseur Bryan Singer bewies, dass Superheldenfilme trotz Humor eine realistische, ernstzunehmende Sache sein können. Die Fortsetzung erhielt noch größeres Kritikerlob, «X-Men: Der letzte Widerstand» erntete unter dem neuen Regisseur Brett Ratner einige harsche Verrisse. 2009 sollte ein Spin-Off mit Publikumsliebling Wolverine die Kinoreihe mit neuer Kraft versehen, aber das Projekt erwies sich nicht gerade als beliebt bei den Fans.
 Auf «X-Men Origins: Wolverine» sollte ursprünglich ein Film über den Serienschurken Magneto folgen, und abhängig von dessen Erfolg hätte man sich für oder gegen ein weiteres Prequel entschieden, dieses Mal über die Formierung der Heldengruppe X-Men. Der zum Franchise zurückgekehrte Bryan Singer fügte in das Drehbuch dieses Prequels allerdings Elemente der angedachten Magneto-Geschichte ein, und so wurde der Grundstein für «X-Men: Erste Entscheidung» gelegt. Singer musste aufgrund anderer Verpflichtungen jedoch den Regieposten abgeben, und so wurde im März 2010 hastig ein neuer Filmemacher engagiert: Matthew Vaughn, der kurz zuvor mit seiner andersartigen und frechen Comicverfilmung «Kick-Ass» für Aufsehen sorgte. Rasch wurde das Drehbuch zu «X-Men: Erste Entscheidung» erneut umgeschrieben, und bei all der Eile kam in der «X-Men»-Fangemeide die Befürchtung auf, die Kinoreihe manövriere sich weiter ins Aus. Ist der Blick in die Vergangenheit der «X-Men» wirklich der richtige Schritt in die Zukunft des Franchises?
Auf «X-Men Origins: Wolverine» sollte ursprünglich ein Film über den Serienschurken Magneto folgen, und abhängig von dessen Erfolg hätte man sich für oder gegen ein weiteres Prequel entschieden, dieses Mal über die Formierung der Heldengruppe X-Men. Der zum Franchise zurückgekehrte Bryan Singer fügte in das Drehbuch dieses Prequels allerdings Elemente der angedachten Magneto-Geschichte ein, und so wurde der Grundstein für «X-Men: Erste Entscheidung» gelegt. Singer musste aufgrund anderer Verpflichtungen jedoch den Regieposten abgeben, und so wurde im März 2010 hastig ein neuer Filmemacher engagiert: Matthew Vaughn, der kurz zuvor mit seiner andersartigen und frechen Comicverfilmung «Kick-Ass» für Aufsehen sorgte. Rasch wurde das Drehbuch zu «X-Men: Erste Entscheidung» erneut umgeschrieben, und bei all der Eile kam in der «X-Men»-Fangemeide die Befürchtung auf, die Kinoreihe manövriere sich weiter ins Aus. Ist der Blick in die Vergangenheit der «X-Men» wirklich der richtige Schritt in die Zukunft des Franchises?Der kalte Krieg ist im vollen Gange. Die USA und die Sowjetunion überbieten sich im nuklearen Wettrüsten, ein Korsett der Angst schürt die Weltbevölkerung. Die CIA-Agentin MacTaggert (Rose Byrne) wird Zeugin, wie ein Colonel von Menschen mit Superkräften erpresst wird, seine Stimme für die Stationierung atomarer Raketen in der Türkei zu stimmen. Ihre Vorgesetzten halten MacTaggert für verrückt, weshalb sie sich zur Stützung ihrer These auf die Suche nach einem Genetik-Professor macht, der derartige Mutationen für möglich hält. Sie stößt auf Charles „Professor X“ Xavier (James McAvoy), der über telepathische Fähigkeiten verfügt. Xavier und seine formwandelnde Sandkastenfreundin Raven können das CIA überzeugen, woraufhin der Geheimdienst eine Eliteeinheit von Mutanten erstellt, um den drohenden Dritten Weltkrieg abzuwenden. Während seiner ersten Mission begegnet Xavier dem Mutanten Erik „Magneto“ Lehnsherr (Michael Fassbender), der sich seit Jahren auf der Suche nach Blutrache befindet: Er ist Überlebender des Holocaust und sucht den kaltblütigen Mörder seiner Mutter, den Ex-Nazi Sebastian Shaw (Kevin Bacon). Der treibt mittlerweile seine Spielchen als durchtriebener Strippenzieher auf dem internationalen, politischen Parkett, und so willigt Lehnsherr ein, sich Xavier anzuschließen…
 Fassbender ist der unbestrittene Star von «X-Men: Erste Entscheidung». Der 1977 geborene Deutsch-Ire drängt sich vielleicht nicht mit solch einer Kraft ins kollektive Bild seiner Figur, wie es Hugh Jackman mit Wolverine oder Robert Downey junior mit Iron Man tat, aber er gibt eine wundervoll nuancierte Performance ab. Fassbender schöpft durch seine Unaufgeregtheit und Ausstrahlung neue Sympathien für Erik. Es fällt letzten Endes schwer, ihn nicht als den tragischen Helden des Films zu betrachten. Dabei wird Fassbender vom durch zahlreiche Hände gereichten Drehbuch unterstützt, dessen größte Stärke die ausdifferenzierte und stets nachvollziehbare Charakterzeichnung von Erik Lensherr ist.
Fassbender ist der unbestrittene Star von «X-Men: Erste Entscheidung». Der 1977 geborene Deutsch-Ire drängt sich vielleicht nicht mit solch einer Kraft ins kollektive Bild seiner Figur, wie es Hugh Jackman mit Wolverine oder Robert Downey junior mit Iron Man tat, aber er gibt eine wundervoll nuancierte Performance ab. Fassbender schöpft durch seine Unaufgeregtheit und Ausstrahlung neue Sympathien für Erik. Es fällt letzten Endes schwer, ihn nicht als den tragischen Helden des Films zu betrachten. Dabei wird Fassbender vom durch zahlreiche Hände gereichten Drehbuch unterstützt, dessen größte Stärke die ausdifferenzierte und stets nachvollziehbare Charakterzeichnung von Erik Lensherr ist. Neben dem seine Rolle völlig einvernehmenden Fassbender lädt Co-Star James McAvoy eher zu Qualitätsdiskussionen mit unklarem Ausgang ein. Anders als Fassbender kann McAvoy nicht ganz aus dem Schatten seines Vorgängers (bzw. chronologisch gesehen Nachfolgers) in der Rolle des Professor Xavier schreiten. Schnell entsteht der Eindruck, dass er mit seiner Mimik und Gestik eine unausgefeilte Imitation von Patrick Stewartzum Besten geben will. Im Zusammenspiel mit Fassbender ist McAvoy sehr gut, sie teilen berührende Momente mit ebensolcher Glaubwürdigkeit, wie sie sich in einer pfiffigen, amüsanten Montage augenzwinkernd die Bälle zuspielen. Trotzdem ist McAvoys Repertoire als Xavier zu einseitig, er holt viel zu häufig den selben, idealistischen, zerknautschten Blick der Hoffnung raus (eine grübelnde Faltenstirn mit optimistischem Funkeln in den Augen). Hinzu kommt, dass das Drehbuch Xavier wesentlich einseitiger zeichnet und die wenigen Risse in seinem Strahlemann-Auftreten von McAvoy kurzerhand übertrieben kaltschnäuzig rübergebracht werden. Das polstert letzten Endes das Verständnis, das man als Zuschauer für Erik aufbringen kann, hundertprozentig im Sinne der Filmemacher scheint dies jedoch nicht zu sein.
 Kevin Bacon tritt derweil, sozusagen als Gegenpol zum ambivalent gezeichneten Erik, als brillant überzeichneter Comicschurke Sebastian Shaw auf. Er ist schmierig, er ist opportunistisch, und er genießt sich dabei in vollen Zügen selbst. Bacon stiehlt seinen Leinwandkollegen und -widersachern nahezu jede Szene, in der er zu sehen ist, sei es als genussvolle Schurkenkarikatur im James-Bond-Stil (der Ära Sean Connery, selbstredend) oder auch als ohne ironische Brechungen gezeichnete, Furcht einflößende Gestalt, wie er sich im Prolog von «X-Men: Erste Entscheidung» präsentiert. Der Rest des Ensembles ist durchgehend solide, mit der einzigen Ausnahme von January Jones als die schurkische Telepatin Emma Frost. Jones ist in ihrem Schauspiel steif, emotionslos und langweilig. Außerdem wird Jennifer Lawrence (Oscar-nominiert für «Winter‘s Bone») in ihrer Rolle der Formwandlerin Raven/Mystique nicht gänzlich ihrem Ruf gerecht, und das, obwohl Mystique im Vergleich zu den restlichen «X-Men»-Filmen an charakterlicher Feinzeichnung hinzugewonnen hat. Für Lawrences schwächere Momente entschädigt allerdings eine umso kraftvollere Leistung in ihren Schlüsselszenen mit McAvoy und Fassbender.
Kevin Bacon tritt derweil, sozusagen als Gegenpol zum ambivalent gezeichneten Erik, als brillant überzeichneter Comicschurke Sebastian Shaw auf. Er ist schmierig, er ist opportunistisch, und er genießt sich dabei in vollen Zügen selbst. Bacon stiehlt seinen Leinwandkollegen und -widersachern nahezu jede Szene, in der er zu sehen ist, sei es als genussvolle Schurkenkarikatur im James-Bond-Stil (der Ära Sean Connery, selbstredend) oder auch als ohne ironische Brechungen gezeichnete, Furcht einflößende Gestalt, wie er sich im Prolog von «X-Men: Erste Entscheidung» präsentiert. Der Rest des Ensembles ist durchgehend solide, mit der einzigen Ausnahme von January Jones als die schurkische Telepatin Emma Frost. Jones ist in ihrem Schauspiel steif, emotionslos und langweilig. Außerdem wird Jennifer Lawrence (Oscar-nominiert für «Winter‘s Bone») in ihrer Rolle der Formwandlerin Raven/Mystique nicht gänzlich ihrem Ruf gerecht, und das, obwohl Mystique im Vergleich zu den restlichen «X-Men»-Filmen an charakterlicher Feinzeichnung hinzugewonnen hat. Für Lawrences schwächere Momente entschädigt allerdings eine umso kraftvollere Leistung in ihren Schlüsselszenen mit McAvoy und Fassbender.Hinsichtlich der Spezialeffekte ist «X-Men: Erste Entscheidung» für eine große Hollywoodproduktion, und noch dazu Teil einer etablierten und erfolgreichen Kinoreihe, erstaunlich inkonsistent. In der ersten Effektszene raubt die beinahe schon erbärmliche technische Umsetzung viel von der Intensität und Glaubwürdigkeit dieser Sequenz, auch der Mutant Beast leidet unter Effektarbeit, die eher an vergangene Tage mäßiger Spezialmasken erinnert, als an einen topaktuellen Blockbuster. Von diesen massiven Schnitzern abgesehen, bewegen sich die digitale und praktische Effektarbeit auf einem soliden Niveau. In den größeren Actionsequenzen steigert sich die Qualität der Spezialeffekte sogar, so dass in «X-Men: Erste Entscheidung» für die Standards in modernen Sommer-Actionstreifen vergleichsweise maue Momente neben erstaunlich guten stehen.
 Ansonsten ist «X-Men: Erste Entscheidung» technisch überaus gelungen. Kameraarbeit und Schnitt sorgen für temporeiche Actionszenen, in denen der Zuschauer weiterhin die Übersicht behält und Komponist Henry Jackman («Kick-Ass») verhilft mit seinen Kompositionen, dem Film das Feeling eines 60er-Jahre-Agentenstreifens zu verleihen. Mit einigen gefühlvolleren Musikthemen unterstreicht Jackman auch die bewegenden Momente von «X-Men: Erste Entscheidung» wirkungsvoll. Die Ausstattung wiederum ist zwar ausschweifend, von der Aufmachung Emma Frosts sowie einigem, wenigen technischen Gerät verleiht sie jedoch keinerlei 60er-Flair. Ohne Emmas Föhnfrisur und die inhaltliche Verwebung in den kalten Krieg, könnte man glatt die Vermutung aufstellen, der Film spiele in der Gegenwart.
Ansonsten ist «X-Men: Erste Entscheidung» technisch überaus gelungen. Kameraarbeit und Schnitt sorgen für temporeiche Actionszenen, in denen der Zuschauer weiterhin die Übersicht behält und Komponist Henry Jackman («Kick-Ass») verhilft mit seinen Kompositionen, dem Film das Feeling eines 60er-Jahre-Agentenstreifens zu verleihen. Mit einigen gefühlvolleren Musikthemen unterstreicht Jackman auch die bewegenden Momente von «X-Men: Erste Entscheidung» wirkungsvoll. Die Ausstattung wiederum ist zwar ausschweifend, von der Aufmachung Emma Frosts sowie einigem, wenigen technischen Gerät verleiht sie jedoch keinerlei 60er-Flair. Ohne Emmas Föhnfrisur und die inhaltliche Verwebung in den kalten Krieg, könnte man glatt die Vermutung aufstellen, der Film spiele in der Gegenwart.Regisseur Matthew Vaughn, seines Zeichens großer «James Bond»-Fan, sorgt mit seiner Inszenierung dessen ungeachtet für einen erfrischenden Spritzer Retro-Feeling. In den lockeren Phasen von «X-Men: Erste Entscheidung» wartet man förmlich darauf, dass gleich ein Martiniglas schwenkender Geheimagent um die Ecke spaziert kommt, und diese Grundstimmung eines 60er-Agentenabenteuers passt wirklich gut zu den «X-Men». Dadurch, dass der Science-Fiction-Aspekt weniger hervorgekehrt wird, erhält «X-Men: Erste Entscheidung» eine grundlegende Bodenständigkeit, gleichzeitig verleiht dieses Agentenformat dem Film eine löbliche Spritzigkeit. Auf dieser Basis kann Vaughn die Stärken der «X-Men»-Reihe sehr gut ausspielen: Wie auch die Vorlagen ist «X-Men: Erste Entscheidung» sehr kurzweilige Unterhaltung, die sich aber nicht scheut, solche Themen wie Intoleranz, gesellschaftliches Angstklima oder die Suche nach (Selbst-)Akzeptanz anzupacken.
Bei diesem Balanceakt zwischen sorglosem und nachdenklichem Popcornkino profitiert Matthew Vaughn überdeutlich von seiner Erfahrung mit der Comicadaption «Kick-Ass». Die unkonventionelle Superheldengeschichte war Genre-Dekonstruktion und -Hommage zugleich, und zwischen ihren gewollt albernen, knalligen Lachern äußerte sie schwarzhumorige Gesellschaftskritik. In «X-Men: Erste Entscheidung» vollführt Vaughn zwar nicht solch krasse Stimmungswechsel wie in «Kick-Ass», aber man darf trotzdem erstaunt sein, wie gut er grundsätzlich verschiedene Herangehensweisen an den Stoff unter einen Hut bringt.
 Die packende Inszenierung hilft auch, darüber hinwegzusehen, dass gerade im letzten Akt einige einschneidende Momente etwas abgehetzt wirken. Von den ersten Sekunden an ist «X-Men: Erste Entscheidung» spannend, ganz gebannt verfolgt man, wie sich die Figuren unaufhaltsam ihrem bereits bekannten Schicksal nähern. Deshalb dürfte «X-Men: Erste Entscheidung» für Leute mit Vorkenntnissen der Comic- und/oder Filmreihe tatsächlich für mehr Vergnügen am Film sorgen, als bei vollkommen unwissenden Neulingen. Kenner der Filmreihe müssen sich allerdings darauf einstellen, dass es dieses Prequel mit der etablierten Kontinuität nicht sonderlich streng nimmt. Es versucht vor allem, eine eigene, gute Geschichte zu erzählen, und ist deshalb eher als Reboot im Sinne des letzten «Star Trek»-Films zu verstehen. Den Preis der Kontinuität zahlt man angesichts dieses spannenden, unterhaltsamen und recht smarten Stücks Sommerunterhaltung aber sehr gerne.
Die packende Inszenierung hilft auch, darüber hinwegzusehen, dass gerade im letzten Akt einige einschneidende Momente etwas abgehetzt wirken. Von den ersten Sekunden an ist «X-Men: Erste Entscheidung» spannend, ganz gebannt verfolgt man, wie sich die Figuren unaufhaltsam ihrem bereits bekannten Schicksal nähern. Deshalb dürfte «X-Men: Erste Entscheidung» für Leute mit Vorkenntnissen der Comic- und/oder Filmreihe tatsächlich für mehr Vergnügen am Film sorgen, als bei vollkommen unwissenden Neulingen. Kenner der Filmreihe müssen sich allerdings darauf einstellen, dass es dieses Prequel mit der etablierten Kontinuität nicht sonderlich streng nimmt. Es versucht vor allem, eine eigene, gute Geschichte zu erzählen, und ist deshalb eher als Reboot im Sinne des letzten «Star Trek»-Films zu verstehen. Den Preis der Kontinuität zahlt man angesichts dieses spannenden, unterhaltsamen und recht smarten Stücks Sommerunterhaltung aber sehr gerne. «X-Men: Erste Entscheidung» ist seit dem 9. Juni in vielen deutschen Kinos zu sehen.








 You Are Cancelled: «Skins»
You Are Cancelled: «Skins» Die Kritiker: «Mankells Wallander: Inkasso»
Die Kritiker: «Mankells Wallander: Inkasso»









 Logger (m/w/d) im Bereich Reality am Standort Ismaning bei München und teilweise im Ausland in befristeter Anstellung / freier Mitarbeit
Logger (m/w/d) im Bereich Reality am Standort Ismaning bei München und teilweise im Ausland in befristeter Anstellung / freier Mitarbeit Aufnahmeleitungs-Assistenz (w/m/d)
Aufnahmeleitungs-Assistenz (w/m/d) Kameramann / Cutter (m/w/d)
Kameramann / Cutter (m/w/d)