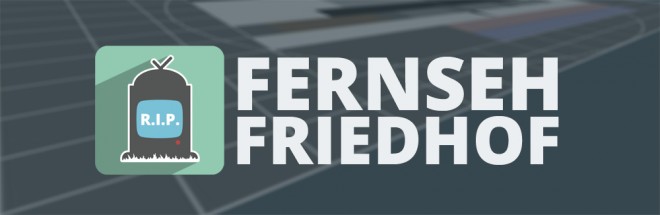
Der Tag, an dem das Privatfernsehen erwachsen wurde
Christian Richter erinnert an all die Fernsehformate, die längst im Schleier der Vergessenheit untergegangen sind. Folge 331: Vom «Familienduell» bis «Hans Meiser» - eine Reise in die bewegte Vergangenheit von RTLplus.
Liebe Fernsehgemeinde, heute gedenken wir der Zeit, als die letzte Torte flog…
 Irgendwann im Leben kommt der Punkt, an dem die Kindheit endgültig vorbei ist. Es ist der Punkt, an dem man seine Naivität vollständig ablegt und aufhört nur herumzuspielen. Es ist der Punkt, an dem der „Ernst des Lebens“ beginnt. Genauso verhielt es sich mit dem deutschen Privatfernsehen, das anfangs harmlos herumtollte und von den öffentlich-rechtlichen Erwachsenen allenfalls belächelt wurde, bevor es seinen eigenen Weg fand und aus dem Schatten der älteren Generation heraustreten konnte. Ähnlich wie beim Menschen, wo allgemeinhin mit dem 18. Geburtstag ein konkreter Tag zum Abschluss der Kindheit festgelegt wird, lässt sich das Erwachsenwerden des Privatfernsehens in Deutschland auf den 01. November 1992 datieren. An diesem Tag nämlich legte es unwiderruflich seine Arglosigkeit ab und emanzipierte sich als eine eigene maßgebliche Säule der deutschen Medienlandschaft.
Irgendwann im Leben kommt der Punkt, an dem die Kindheit endgültig vorbei ist. Es ist der Punkt, an dem man seine Naivität vollständig ablegt und aufhört nur herumzuspielen. Es ist der Punkt, an dem der „Ernst des Lebens“ beginnt. Genauso verhielt es sich mit dem deutschen Privatfernsehen, das anfangs harmlos herumtollte und von den öffentlich-rechtlichen Erwachsenen allenfalls belächelt wurde, bevor es seinen eigenen Weg fand und aus dem Schatten der älteren Generation heraustreten konnte. Ähnlich wie beim Menschen, wo allgemeinhin mit dem 18. Geburtstag ein konkreter Tag zum Abschluss der Kindheit festgelegt wird, lässt sich das Erwachsenwerden des Privatfernsehens in Deutschland auf den 01. November 1992 datieren. An diesem Tag nämlich legte es unwiderruflich seine Arglosigkeit ab und emanzipierte sich als eine eigene maßgebliche Säule der deutschen Medienlandschaft.
 Der Weg dorthin begann allerdings schon in den Monaten davor, sodass die Ereignisse des ganzen Jahres 1992 dafür eine tragende Rolle spielten. Es war das Jahr, an dem sich der TV-Markt mit dem Zutritt des Kabelkanals (später umbenannt in Kabel eins), der Umtaufung des Westschienenkanals in seinen weiterhin gültigen Namen VOX sowie der Einführung von n-tv als erster deutscher Nachrichtensender entscheidend erweiterte. Das Jahr, in dem die Kanäle begannen, rund um die Uhr zu senden. Und das Jahr, in denen die Programmansagerinnen langsam verschwanden. Es war auch das Jahr, in dem der Begriff Reality-TV erstmals flächendeckend auftauchte und mit ihm eine Reihe von Konzepten, die sich vor allem mit Katastrophen, Unglücken und Kriminalität befassten. Was mit dem unscheinbaren «Polizeibericht Deutschland“ im Januar bei Tele 5 begann, sollte Dank der Nachfolgeformate «Notruf», «Augenzeugen-Videos», «Auf Leben und Tod», «Retter» und «K - Verbrechen im Fadenkreuz» bald große Teile des kommerziellen Angebots füllen und die Skandalisierung des Rundfunks vorantreiben.
Der Weg dorthin begann allerdings schon in den Monaten davor, sodass die Ereignisse des ganzen Jahres 1992 dafür eine tragende Rolle spielten. Es war das Jahr, an dem sich der TV-Markt mit dem Zutritt des Kabelkanals (später umbenannt in Kabel eins), der Umtaufung des Westschienenkanals in seinen weiterhin gültigen Namen VOX sowie der Einführung von n-tv als erster deutscher Nachrichtensender entscheidend erweiterte. Das Jahr, in dem die Kanäle begannen, rund um die Uhr zu senden. Und das Jahr, in denen die Programmansagerinnen langsam verschwanden. Es war auch das Jahr, in dem der Begriff Reality-TV erstmals flächendeckend auftauchte und mit ihm eine Reihe von Konzepten, die sich vor allem mit Katastrophen, Unglücken und Kriminalität befassten. Was mit dem unscheinbaren «Polizeibericht Deutschland“ im Januar bei Tele 5 begann, sollte Dank der Nachfolgeformate «Notruf», «Augenzeugen-Videos», «Auf Leben und Tod», «Retter» und «K - Verbrechen im Fadenkreuz» bald große Teile des kommerziellen Angebots füllen und die Skandalisierung des Rundfunks vorantreiben.
Entscheidender als diese allgemeinen Entwicklungen waren hingegen die Entscheidungen, die in jener Zeit im Hause RTLplus getroffen wurden und die derart wegweisend waren, dass sie das Erscheinungsbild des deutschen Fernsehens bis heute nachhaltig verändert haben. Für diese war maßgeblich ein Mann namens Marc Conrad verantwortlich, der Anfang des Jahres den Posten des Programmdirektors übernahm. Er war zuvor konzernintern vom Nachrichten-Redakteur zum Leiter für Serien- und Filmproduktionen aufgestiegen und erlangte auf seinem Weg das nahezu uneingeschränkte Vertrauen des damaligen Geschäftsführers Helmut Thoma.
 Doch diese Zuneigung teilten nicht alle Mitarbeitende, denn aufgrund seiner oft gnadenlosen Absetzungen, erhielt er intern schnell die Beinamen „Napoleon“ und „Stalin“. Beispielsweise zog er (scheinbar) ohne Zögern den Produktionen «Tutti Frutti», «Alles Nichts Oder!?», «Ein Tag wie kein anderer», «Weiber von Sinnen» und «Eine Chance für die Liebe» den Stecker, obwohl diese zentral für das schrille und unangepasste Image des Senders und damit für dessen Aufstieg waren. Wie für die einst geliebte Holzeisenbahn aus der Kindheit blieb bei Conrads neuem RTLplus kein Platz mehr für Albernheiten, Nostalgie, angestaubte Erotik und fliegende Torten.
Doch diese Zuneigung teilten nicht alle Mitarbeitende, denn aufgrund seiner oft gnadenlosen Absetzungen, erhielt er intern schnell die Beinamen „Napoleon“ und „Stalin“. Beispielsweise zog er (scheinbar) ohne Zögern den Produktionen «Tutti Frutti», «Alles Nichts Oder!?», «Ein Tag wie kein anderer», «Weiber von Sinnen» und «Eine Chance für die Liebe» den Stecker, obwohl diese zentral für das schrille und unangepasste Image des Senders und damit für dessen Aufstieg waren. Wie für die einst geliebte Holzeisenbahn aus der Kindheit blieb bei Conrads neuem RTLplus kein Platz mehr für Albernheiten, Nostalgie, angestaubte Erotik und fliegende Torten.
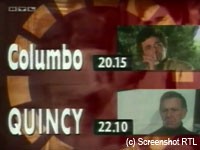 Zusätzlich räumte er das alte Kinderzimmer um und ordnete das darin verbliebene Programm gänzlich neu. Sein erklärtes Ziel war es, dadurch einerseits mehr Verlässlichkeit zu erzeugen und andererseits die Abwanderung des Publikums zwischen einzelnen Sendungen so gering wie möglich zu halten. Dieses (zuletzt genannte) Verfahren des Audience-Flows gehört mittlerweile zum Grundstock einer jeden Programmplanung, wurde allerdings derart umfänglich erstmals von Conrad im Jahr 1992 angewandt. Etwa kramte er die fast vergessene Krimiserie «Quincy» aus dem Archiv und kombinierte sie mit der beliebten Reihe «Columbo» am Montagabend, wodurch er nahezu ohne Kosten einen - wie er es nannte - „homogenen Programmfluss“ erzeugte und im Vergleich zu vorher einen Verlust von zwei Millionen Zuschauenden verhinderte.
Zusätzlich räumte er das alte Kinderzimmer um und ordnete das darin verbliebene Programm gänzlich neu. Sein erklärtes Ziel war es, dadurch einerseits mehr Verlässlichkeit zu erzeugen und andererseits die Abwanderung des Publikums zwischen einzelnen Sendungen so gering wie möglich zu halten. Dieses (zuletzt genannte) Verfahren des Audience-Flows gehört mittlerweile zum Grundstock einer jeden Programmplanung, wurde allerdings derart umfänglich erstmals von Conrad im Jahr 1992 angewandt. Etwa kramte er die fast vergessene Krimiserie «Quincy» aus dem Archiv und kombinierte sie mit der beliebten Reihe «Columbo» am Montagabend, wodurch er nahezu ohne Kosten einen - wie er es nannte - „homogenen Programmfluss“ erzeugte und im Vergleich zu vorher einen Verlust von zwei Millionen Zuschauenden verhinderte.
Mit derartigen Überlegungen verband Conrad zusätzlich ein entschlossenes und flächendeckendes „Stripping“ – also die Schaffung eines täglich identischen und somit verlässlichen Programms. Davor war es nicht unüblich, an jedem Wochentag (auch tagsüber) andere Sendungen zu zeigen und sogar die Anfangszeiten der Primetime variieren zu lassen. Mit der Vereinheitlichung hatte man bei RTLplus bereits zwei Jahre zuvor begonnen und perfektionierte es unter Conrad. Seine Idealvorstellung war es dabei, das eigene Programm derart erwartbar zu gestalten, dass kein Blick in die Fernsehzeitschrift mehr nötig sein würde. Darum fuhr er gleichzeitig den Einsatz von Spielfilmen drastisch zurück, deren unterschiedliche Längen sein einheitliches Schema torpedierten.
 Um einen täglich nicht unterscheidbaren Ablauf gewährleisten zu können, musste Conrad Reihen etablieren, deren Herstellung derart effizient und standardisiert war, dass die Versorgung mit täglich neuen Ausgaben zu geringen Kosten gewährleistet werden konnte. Damit wurden TV-Formate erstmals nicht mehr als reine kreative Kunstobjekte betrachtet, ab jetzt waren sie Industrieware, die quasi am Fließband zu produzieren war und deren Anfertigung nie ins Stocken geraten durfte. Hier entwickelte sich das «Familienduell» mit Werner Schulze-Erdel, das im Jahr 1992 erstmals über den Schirm flimmerte, als ein Lehrstück für solche industrielle Fernsehware, da pro Produktionstag gleich mehrere Folgen am Stück aufgenommen werden konnten und die Abläufe – selbst die Sätze des Moderators - derart normiert und schematisiert waren, dass jede Einheit der anderen glich, wie ein VW Käfer dem anderen. Fließbandarbeit eben. Vorhersehbarer kann Fernsehen kaum sein.
Um einen täglich nicht unterscheidbaren Ablauf gewährleisten zu können, musste Conrad Reihen etablieren, deren Herstellung derart effizient und standardisiert war, dass die Versorgung mit täglich neuen Ausgaben zu geringen Kosten gewährleistet werden konnte. Damit wurden TV-Formate erstmals nicht mehr als reine kreative Kunstobjekte betrachtet, ab jetzt waren sie Industrieware, die quasi am Fließband zu produzieren war und deren Anfertigung nie ins Stocken geraten durfte. Hier entwickelte sich das «Familienduell» mit Werner Schulze-Erdel, das im Jahr 1992 erstmals über den Schirm flimmerte, als ein Lehrstück für solche industrielle Fernsehware, da pro Produktionstag gleich mehrere Folgen am Stück aufgenommen werden konnten und die Abläufe – selbst die Sätze des Moderators - derart normiert und schematisiert waren, dass jede Einheit der anderen glich, wie ein VW Käfer dem anderen. Fließbandarbeit eben. Vorhersehbarer kann Fernsehen kaum sein.
 Unter ähnlichen Produktionsbedingungen entstanden ebenso die täglichen Talkshows, die das deutsche Fernsehen für rund zwei Jahrzehnte dominierte. Deren erste Variante «Hans Meiser» mit dem gleichnamigen Nachrichtensprecher erblickte während Conrads Amtszeit im Mai 1992 das Licht der Welt. Mit ihr entstand erstmals ein fester, verlässlicher, ritualisierter und täglich wiederkehrender Rahmen für intime Einblicke in das Privatleben „einfacher“ Menschen. Ein Ansatz, den das Fernsehen bis heute exzessiv genutzt hat - egal ob bei «Frauentausch», bei «Big Brother» oder bei «Das perfekte Dinner».
Unter ähnlichen Produktionsbedingungen entstanden ebenso die täglichen Talkshows, die das deutsche Fernsehen für rund zwei Jahrzehnte dominierte. Deren erste Variante «Hans Meiser» mit dem gleichnamigen Nachrichtensprecher erblickte während Conrads Amtszeit im Mai 1992 das Licht der Welt. Mit ihr entstand erstmals ein fester, verlässlicher, ritualisierter und täglich wiederkehrender Rahmen für intime Einblicke in das Privatleben „einfacher“ Menschen. Ein Ansatz, den das Fernsehen bis heute exzessiv genutzt hat - egal ob bei «Frauentausch», bei «Big Brother» oder bei «Das perfekte Dinner».
 Die industrielle Produktion war jedoch nicht auf Showprojekte begrenzt, sondern fand mit der Einführung von «Gute Zeiten, Schlechte Zeiten» im selben Jahr ihr Pendant im fiktiven Bereich. Mit dieser Serie bot RTL nun jeden Abend pünktlich zum Abendbrot eine Handvoll dramatischer Geschichten an - platziert übrigens schon damals um 19.40 Uhr, also auf jenem Slot, den sie bis heute nie verloren hat. Zusammen mit dem ebenfalls neu eingeführten «Explosiv – Das Magazin» löste sie die bisher werktäglich wechselnde Jonglage der US-Serien «A-Team» (montags), «Knight Rider» (dienstags), «Zurück in die Vergangenheit» (mittwochs), «21 Jump Street» (donnerstags) sowie «Pazifikgeschwader 214» (freitags) ab und verlängerte das Stripping auf diese Weise bis in den Vorabend hinein.
Die industrielle Produktion war jedoch nicht auf Showprojekte begrenzt, sondern fand mit der Einführung von «Gute Zeiten, Schlechte Zeiten» im selben Jahr ihr Pendant im fiktiven Bereich. Mit dieser Serie bot RTL nun jeden Abend pünktlich zum Abendbrot eine Handvoll dramatischer Geschichten an - platziert übrigens schon damals um 19.40 Uhr, also auf jenem Slot, den sie bis heute nie verloren hat. Zusammen mit dem ebenfalls neu eingeführten «Explosiv – Das Magazin» löste sie die bisher werktäglich wechselnde Jonglage der US-Serien «A-Team» (montags), «Knight Rider» (dienstags), «Zurück in die Vergangenheit» (mittwochs), «21 Jump Street» (donnerstags) sowie «Pazifikgeschwader 214» (freitags) ab und verlängerte das Stripping auf diese Weise bis in den Vorabend hinein.
Neben der Etablierung eines durchgehenden Flows und der Einführung eines verlässlichen Ablaufs führte Conrad zusätzlich die konsequente Orientierung an den sogenannten „Key-Demographics“ ein. Dahinter verbarg sich die heute stärker denn je betriebene Fokussierung auf eine bestimmte anvisierte Zielgruppe – mittlerweile meist der Personen in einem Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Damals konzentrierte man sich zwar noch auf die 18- bis 49-Jährigen als Kerngruppe, doch unverändert galt und gilt, das Programm soweit zu optimieren, dass bloß noch jene Personen angesprochen werden, die für die Werbewirtschaft relevant sind. Dies soll für die Werbetreibenden einen möglichst geringen Streuverlust gewährleisten, was wiederum höhere Preise für die Schaltung von Werbespots rechtfertigt. Vergleichbar mit Jugendlichen, die irgendwann beginnen, lieber etwas mit Altersgenossen zu unternehmen, als mit ihren Großeltern am Kaffeetisch zu sitzen.
 In diesem Zuge beendete Conrad zuerst Produktionen wie «Die Heimatmelodie», «Musikrevue» und «Sielmann 2000», die in seinen Augen das falsche Publikum anlockten. Darüber hinaus mussten die beliebten Gameshows «Riskant» und «Der Preis ist heiß» ihren langjährigen Platz am Vorabend räumen und auf den Vormittag um 10.30 Uhr umziehen. „Nicht weil sie schlechte Zahlen hätten“, wie Conrad in einem viel zitierten Interview mit dem Fachblatt Funkkorrespondenz versicherte, „ich verlege sie, weil ihre Zuschauer mir insgesamt zu alt sind.“ Ihren Platz um 17.00 Uhr nahmen tägliche Ausstrahlungen der US-Sitcoms «Wer ist hier der Boss?» und «Eine schrecklich nette Familie» ein, die zwar weniger Menschen erreichten, aber „die Leute, die uns sehen, die passen dann viel besser in die von uns angepeilten ‚Key-Demographics‘ hinein.“
In diesem Zuge beendete Conrad zuerst Produktionen wie «Die Heimatmelodie», «Musikrevue» und «Sielmann 2000», die in seinen Augen das falsche Publikum anlockten. Darüber hinaus mussten die beliebten Gameshows «Riskant» und «Der Preis ist heiß» ihren langjährigen Platz am Vorabend räumen und auf den Vormittag um 10.30 Uhr umziehen. „Nicht weil sie schlechte Zahlen hätten“, wie Conrad in einem viel zitierten Interview mit dem Fachblatt Funkkorrespondenz versicherte, „ich verlege sie, weil ihre Zuschauer mir insgesamt zu alt sind.“ Ihren Platz um 17.00 Uhr nahmen tägliche Ausstrahlungen der US-Sitcoms «Wer ist hier der Boss?» und «Eine schrecklich nette Familie» ein, die zwar weniger Menschen erreichten, aber „die Leute, die uns sehen, die passen dann viel besser in die von uns angepeilten ‚Key-Demographics‘ hinein.“
 Ein weiterer zentraler Baustein in Conrads Strategie bildete das ebenfalls im Jahr 1992 neu eingeführte «Gottschalk Late Night», welches allein deswegen als bahnbrechend galt, weil es die erste Nachtshow nach amerikanischem Vorbild im deutschen Fernsehen war und selbst den späten Platz um 23.00 Uhr noch mit neuer Ware und bekannten Gesichtern bespielte. Wichtiger für Conrad war aber die Tatsache, dass es durch sie gelang, eine verlässliche werktägliche Programmierung auch am späten Abend zu gewährleisten. Zugleich stellte sie sich als „Bombengeschäft“ heraus, wie Conrad bestätigte: „Da sitzt nicht zufällig ein für die Werbekunden um diese Zeit ja uninteressanter Opa vor dem Bildschirm, nur weil er Schlafstörungen hat, sondern wir erreichen praktisch hundertprozentig Zuschauer aus der Zielgruppe, die uns und die Werbekunden auch interessiert.“ Deshalb wäre ihm diese Reihe lieber gewesen, als die vorher auf diesem Slot gezeigten Sexfilmchen, die zwar insgesamt ein paar hunderttausend Zuschauende mehr erreichten, aber einen viel größeren Streuverlust hatten.
Ein weiterer zentraler Baustein in Conrads Strategie bildete das ebenfalls im Jahr 1992 neu eingeführte «Gottschalk Late Night», welches allein deswegen als bahnbrechend galt, weil es die erste Nachtshow nach amerikanischem Vorbild im deutschen Fernsehen war und selbst den späten Platz um 23.00 Uhr noch mit neuer Ware und bekannten Gesichtern bespielte. Wichtiger für Conrad war aber die Tatsache, dass es durch sie gelang, eine verlässliche werktägliche Programmierung auch am späten Abend zu gewährleisten. Zugleich stellte sie sich als „Bombengeschäft“ heraus, wie Conrad bestätigte: „Da sitzt nicht zufällig ein für die Werbekunden um diese Zeit ja uninteressanter Opa vor dem Bildschirm, nur weil er Schlafstörungen hat, sondern wir erreichen praktisch hundertprozentig Zuschauer aus der Zielgruppe, die uns und die Werbekunden auch interessiert.“ Deshalb wäre ihm diese Reihe lieber gewesen, als die vorher auf diesem Slot gezeigten Sexfilmchen, die zwar insgesamt ein paar hunderttausend Zuschauende mehr erreichten, aber einen viel größeren Streuverlust hatten.
Die von Conrad angestoßenen Veränderungen und Maßnahmen zeigten schnell Erfolg, sodass der Kanal am Ende des Jahres erstmals die Marktführerschaft in der jungen Zielgruppe übernehmen und diese jahrzehntelang behalten konnte. Dies ging an der Konkurrenz nicht unbemerkt vorbei, die (egal ob privat oder öffentlich-rechtlich) begann, diese Prinzipien zu kopieren, weswegen sich das gesamte deutschsprachige Angebot innerhalb kürzester Zeit aneinander angleichte.
 Um diese marktbeherrschende Position künftig halten zu können, so war sich Conrad sicher, war es für RTLplus nötig, die Nachrichten auszubauen: „Man kann nämlich nur die Marktführerschaft mit dem gesamten Sender halten, wenn man auch auf dem Nachrichtensektor die Nummer 1 ist und ernst genommen wird.“ Als Erwachsener muss man sich eben mit Politik befassen. Deshalb begann Conrad, seine Nachrichten kontinuierlich auszubauen, aufzuwerten und zu einer vertrauenswürdigen Marke zu bündeln. Dazu gehörte neben der einheitlichen Gestaltung der existierenden Ausgaben deren Ergänzung um ein Mittagsmagazin, welches ab 1992 zunächst unter dem Titel «Zwölfdreißig» startete. Ab Juni wanderte es eine halbe Stunde nach vorn und erhielt den nach wie vor gültigen Namen «Punkt 12». Zeitgleich erfuhr der bisherige Redakteur Peter Kloeppel seine Beförderung zum Hauptnachrichtensprecher und stieg zum bis heute vielleicht wichtigsten Gesicht des Unternehmens auf.
Um diese marktbeherrschende Position künftig halten zu können, so war sich Conrad sicher, war es für RTLplus nötig, die Nachrichten auszubauen: „Man kann nämlich nur die Marktführerschaft mit dem gesamten Sender halten, wenn man auch auf dem Nachrichtensektor die Nummer 1 ist und ernst genommen wird.“ Als Erwachsener muss man sich eben mit Politik befassen. Deshalb begann Conrad, seine Nachrichten kontinuierlich auszubauen, aufzuwerten und zu einer vertrauenswürdigen Marke zu bündeln. Dazu gehörte neben der einheitlichen Gestaltung der existierenden Ausgaben deren Ergänzung um ein Mittagsmagazin, welches ab 1992 zunächst unter dem Titel «Zwölfdreißig» startete. Ab Juni wanderte es eine halbe Stunde nach vorn und erhielt den nach wie vor gültigen Namen «Punkt 12». Zeitgleich erfuhr der bisherige Redakteur Peter Kloeppel seine Beförderung zum Hauptnachrichtensprecher und stieg zum bis heute vielleicht wichtigsten Gesicht des Unternehmens auf.
Angesichts all dieser Schritte wird deutlich, in welche Richtung der Wandel von RTLplus ging. Ab dem Jahr 1992 standen fortan weniger Spaß und Spielfreude, als vielmehr betriebswirtschaftliche Überlegungen im Vordergrund. Die Zeit des freien Ausprobierens und unbeschwerten Experimentierens war unwiderruflich vorbei. Ab jetzt war Fernsehen durch und durch ein Geschäft. Ein Geschäft wie es typischerweise eher Erwachsene und weniger Kinder betreiben. Und es war (im wahrsten Sinne des Wortes) kein kleines Geschäft, weil es um einen sehr großen Haufen Geld ging. Schließlich prognostizierte Helmut Thoma im Sommer 1992 auf dem Medienforum für das laufende Jahr einen Netto-Umsatz von 1,9 Mrd. DM. Ein absoluter Rekordwert, der so enorm war, dass die Branche allein seinetwegen ihre kindliche Naivität ablegte.
 Nur eines fehlte zur vollständigen Abnabelung - noch immer galt der Fernsehsender als Anhängsel (oder Nachkomme) des Radioprogramms, aus dem er ursprünglich hervorgegangen war. Deutlich wurde dies darin, dass der TV-Ableger den Zusatz „plus“ im Namen trug. Dieser degradierte das Haus quasi zu einem RTL Junior. Das aber war angesichts dieser beeindruckenden Bilanz längst überholt, was Conrad dringend nach außen zum Ausdruck bringen wollte. Nach einjährigen Verhandlungen mit dem Mutterkonzern erreichte er endlich, dass ab dem 01. November 1992 der ungeliebte Anhang gestrichen werden konnte.
Nur eines fehlte zur vollständigen Abnabelung - noch immer galt der Fernsehsender als Anhängsel (oder Nachkomme) des Radioprogramms, aus dem er ursprünglich hervorgegangen war. Deutlich wurde dies darin, dass der TV-Ableger den Zusatz „plus“ im Namen trug. Dieser degradierte das Haus quasi zu einem RTL Junior. Das aber war angesichts dieser beeindruckenden Bilanz längst überholt, was Conrad dringend nach außen zum Ausdruck bringen wollte. Nach einjährigen Verhandlungen mit dem Mutterkonzern erreichte er endlich, dass ab dem 01. November 1992 der ungeliebte Anhang gestrichen werden konnte.
 Damit einher ging die Ablösung des alten Logos, welches Conrad ebenso ein Dorn im Auge war: „Versuchen Sie dieses alte RTL-plus-Logo mal nachzuzeichnen“, beschwerte er sich damals im Interview. „Sie werden es nicht schaffen.“ Gemeint war jenes Logo, bei dem sich die drei Haus-Buchstaben an ihren jeweiligen Rücken trafen und eine Art Fächer bildeten. „Das Ganze erinnerte eher an ein aufgeschlagenes Buch als an ein Logo für einen Fernsehsender“, beschrieb es rückblickend die Literaturwissenschaftlerin Christina Scherer. Der Buchstaben-Fächer wich letztlich dem bis heute genutzten aus drei Rechtecken bestehenden Markenzeichen.
Damit einher ging die Ablösung des alten Logos, welches Conrad ebenso ein Dorn im Auge war: „Versuchen Sie dieses alte RTL-plus-Logo mal nachzuzeichnen“, beschwerte er sich damals im Interview. „Sie werden es nicht schaffen.“ Gemeint war jenes Logo, bei dem sich die drei Haus-Buchstaben an ihren jeweiligen Rücken trafen und eine Art Fächer bildeten. „Das Ganze erinnerte eher an ein aufgeschlagenes Buch als an ein Logo für einen Fernsehsender“, beschrieb es rückblickend die Literaturwissenschaftlerin Christina Scherer. Der Buchstaben-Fächer wich letztlich dem bis heute genutzten aus drei Rechtecken bestehenden Markenzeichen.
An jenem Tag, als RTL nach umfangreichen Umgestaltungen sein neuen Look der Welt präsentierte, trat es sowohl inhaltlich als auch visuell aus dem Schatten seiner piefigen Radiovergangenheit heraus und ebnete seinen eigenen erfolgsversprechenden Weg. Einen Weg, dem all die anderen Privatsender beeindruckt folgten. An jenem 01. November des Jahres 1992, dem Tag, als RTL sein „plus“ verlor, wurde aus dem jugendlichen Draufgänger eine geschäftstüchtige, berechnende und unabhängige Person. An diesem Tag wurde RTL und mit ihm das ganze deutsche Privatfernsehen endgültig erwachsen.
Seine Blütezeit sollte allerdings nur knapp vier Jahre betragen, denn am 09. Dezember 1995 war es bereits an seinem Zenit angekommen, wie hier nachzulesen ist. Marc Conrad blieb derweil bis 1999 Programmdirektor und verließ den Konzern zusammen mit seinem einstigen Mentor Helmut Thoma. Vollständig löste er sich von seiner alten Heimat dabei nicht, steuerte seine Firma Typhoon doch dann zahlreiche TV-Movies sowie die Shows «Freitag Nacht News», «Mein Morgen» und «Dritte Halbzeit» zum Portfolio des Hauses zu. Im Jahr 2004 kehrte er schließlich als Geschäftsführer zurück, behielt diesen Posten jedoch lediglich ein Vierteljahr. Zu diesem Zeitpunkt war sein früheres Glanzstück aber längst in eine lähmende Routine verfallen.
Die nächste Ausgabe des Fernsehfriedhofs erscheint am Donnerstag, den 11. Mai 2017 und widmet sich dann sieben vergessenen Shows, in denen man Millionär werden konnte.
 Irgendwann im Leben kommt der Punkt, an dem die Kindheit endgültig vorbei ist. Es ist der Punkt, an dem man seine Naivität vollständig ablegt und aufhört nur herumzuspielen. Es ist der Punkt, an dem der „Ernst des Lebens“ beginnt. Genauso verhielt es sich mit dem deutschen Privatfernsehen, das anfangs harmlos herumtollte und von den öffentlich-rechtlichen Erwachsenen allenfalls belächelt wurde, bevor es seinen eigenen Weg fand und aus dem Schatten der älteren Generation heraustreten konnte. Ähnlich wie beim Menschen, wo allgemeinhin mit dem 18. Geburtstag ein konkreter Tag zum Abschluss der Kindheit festgelegt wird, lässt sich das Erwachsenwerden des Privatfernsehens in Deutschland auf den 01. November 1992 datieren. An diesem Tag nämlich legte es unwiderruflich seine Arglosigkeit ab und emanzipierte sich als eine eigene maßgebliche Säule der deutschen Medienlandschaft.
Irgendwann im Leben kommt der Punkt, an dem die Kindheit endgültig vorbei ist. Es ist der Punkt, an dem man seine Naivität vollständig ablegt und aufhört nur herumzuspielen. Es ist der Punkt, an dem der „Ernst des Lebens“ beginnt. Genauso verhielt es sich mit dem deutschen Privatfernsehen, das anfangs harmlos herumtollte und von den öffentlich-rechtlichen Erwachsenen allenfalls belächelt wurde, bevor es seinen eigenen Weg fand und aus dem Schatten der älteren Generation heraustreten konnte. Ähnlich wie beim Menschen, wo allgemeinhin mit dem 18. Geburtstag ein konkreter Tag zum Abschluss der Kindheit festgelegt wird, lässt sich das Erwachsenwerden des Privatfernsehens in Deutschland auf den 01. November 1992 datieren. An diesem Tag nämlich legte es unwiderruflich seine Arglosigkeit ab und emanzipierte sich als eine eigene maßgebliche Säule der deutschen Medienlandschaft. Der Weg dorthin begann allerdings schon in den Monaten davor, sodass die Ereignisse des ganzen Jahres 1992 dafür eine tragende Rolle spielten. Es war das Jahr, an dem sich der TV-Markt mit dem Zutritt des Kabelkanals (später umbenannt in Kabel eins), der Umtaufung des Westschienenkanals in seinen weiterhin gültigen Namen VOX sowie der Einführung von n-tv als erster deutscher Nachrichtensender entscheidend erweiterte. Das Jahr, in dem die Kanäle begannen, rund um die Uhr zu senden. Und das Jahr, in denen die Programmansagerinnen langsam verschwanden. Es war auch das Jahr, in dem der Begriff Reality-TV erstmals flächendeckend auftauchte und mit ihm eine Reihe von Konzepten, die sich vor allem mit Katastrophen, Unglücken und Kriminalität befassten. Was mit dem unscheinbaren «Polizeibericht Deutschland“ im Januar bei Tele 5 begann, sollte Dank der Nachfolgeformate «Notruf», «Augenzeugen-Videos», «Auf Leben und Tod», «Retter» und «K - Verbrechen im Fadenkreuz» bald große Teile des kommerziellen Angebots füllen und die Skandalisierung des Rundfunks vorantreiben.
Der Weg dorthin begann allerdings schon in den Monaten davor, sodass die Ereignisse des ganzen Jahres 1992 dafür eine tragende Rolle spielten. Es war das Jahr, an dem sich der TV-Markt mit dem Zutritt des Kabelkanals (später umbenannt in Kabel eins), der Umtaufung des Westschienenkanals in seinen weiterhin gültigen Namen VOX sowie der Einführung von n-tv als erster deutscher Nachrichtensender entscheidend erweiterte. Das Jahr, in dem die Kanäle begannen, rund um die Uhr zu senden. Und das Jahr, in denen die Programmansagerinnen langsam verschwanden. Es war auch das Jahr, in dem der Begriff Reality-TV erstmals flächendeckend auftauchte und mit ihm eine Reihe von Konzepten, die sich vor allem mit Katastrophen, Unglücken und Kriminalität befassten. Was mit dem unscheinbaren «Polizeibericht Deutschland“ im Januar bei Tele 5 begann, sollte Dank der Nachfolgeformate «Notruf», «Augenzeugen-Videos», «Auf Leben und Tod», «Retter» und «K - Verbrechen im Fadenkreuz» bald große Teile des kommerziellen Angebots füllen und die Skandalisierung des Rundfunks vorantreiben.Ein Mann räumt auf
Entscheidender als diese allgemeinen Entwicklungen waren hingegen die Entscheidungen, die in jener Zeit im Hause RTLplus getroffen wurden und die derart wegweisend waren, dass sie das Erscheinungsbild des deutschen Fernsehens bis heute nachhaltig verändert haben. Für diese war maßgeblich ein Mann namens Marc Conrad verantwortlich, der Anfang des Jahres den Posten des Programmdirektors übernahm. Er war zuvor konzernintern vom Nachrichten-Redakteur zum Leiter für Serien- und Filmproduktionen aufgestiegen und erlangte auf seinem Weg das nahezu uneingeschränkte Vertrauen des damaligen Geschäftsführers Helmut Thoma.
 Doch diese Zuneigung teilten nicht alle Mitarbeitende, denn aufgrund seiner oft gnadenlosen Absetzungen, erhielt er intern schnell die Beinamen „Napoleon“ und „Stalin“. Beispielsweise zog er (scheinbar) ohne Zögern den Produktionen «Tutti Frutti», «Alles Nichts Oder!?», «Ein Tag wie kein anderer», «Weiber von Sinnen» und «Eine Chance für die Liebe» den Stecker, obwohl diese zentral für das schrille und unangepasste Image des Senders und damit für dessen Aufstieg waren. Wie für die einst geliebte Holzeisenbahn aus der Kindheit blieb bei Conrads neuem RTLplus kein Platz mehr für Albernheiten, Nostalgie, angestaubte Erotik und fliegende Torten.
Doch diese Zuneigung teilten nicht alle Mitarbeitende, denn aufgrund seiner oft gnadenlosen Absetzungen, erhielt er intern schnell die Beinamen „Napoleon“ und „Stalin“. Beispielsweise zog er (scheinbar) ohne Zögern den Produktionen «Tutti Frutti», «Alles Nichts Oder!?», «Ein Tag wie kein anderer», «Weiber von Sinnen» und «Eine Chance für die Liebe» den Stecker, obwohl diese zentral für das schrille und unangepasste Image des Senders und damit für dessen Aufstieg waren. Wie für die einst geliebte Holzeisenbahn aus der Kindheit blieb bei Conrads neuem RTLplus kein Platz mehr für Albernheiten, Nostalgie, angestaubte Erotik und fliegende Torten.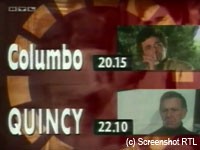 Zusätzlich räumte er das alte Kinderzimmer um und ordnete das darin verbliebene Programm gänzlich neu. Sein erklärtes Ziel war es, dadurch einerseits mehr Verlässlichkeit zu erzeugen und andererseits die Abwanderung des Publikums zwischen einzelnen Sendungen so gering wie möglich zu halten. Dieses (zuletzt genannte) Verfahren des Audience-Flows gehört mittlerweile zum Grundstock einer jeden Programmplanung, wurde allerdings derart umfänglich erstmals von Conrad im Jahr 1992 angewandt. Etwa kramte er die fast vergessene Krimiserie «Quincy» aus dem Archiv und kombinierte sie mit der beliebten Reihe «Columbo» am Montagabend, wodurch er nahezu ohne Kosten einen - wie er es nannte - „homogenen Programmfluss“ erzeugte und im Vergleich zu vorher einen Verlust von zwei Millionen Zuschauenden verhinderte.
Zusätzlich räumte er das alte Kinderzimmer um und ordnete das darin verbliebene Programm gänzlich neu. Sein erklärtes Ziel war es, dadurch einerseits mehr Verlässlichkeit zu erzeugen und andererseits die Abwanderung des Publikums zwischen einzelnen Sendungen so gering wie möglich zu halten. Dieses (zuletzt genannte) Verfahren des Audience-Flows gehört mittlerweile zum Grundstock einer jeden Programmplanung, wurde allerdings derart umfänglich erstmals von Conrad im Jahr 1992 angewandt. Etwa kramte er die fast vergessene Krimiserie «Quincy» aus dem Archiv und kombinierte sie mit der beliebten Reihe «Columbo» am Montagabend, wodurch er nahezu ohne Kosten einen - wie er es nannte - „homogenen Programmfluss“ erzeugte und im Vergleich zu vorher einen Verlust von zwei Millionen Zuschauenden verhinderte.Lass‘ Dich bloß nicht überraschen
Mit derartigen Überlegungen verband Conrad zusätzlich ein entschlossenes und flächendeckendes „Stripping“ – also die Schaffung eines täglich identischen und somit verlässlichen Programms. Davor war es nicht unüblich, an jedem Wochentag (auch tagsüber) andere Sendungen zu zeigen und sogar die Anfangszeiten der Primetime variieren zu lassen. Mit der Vereinheitlichung hatte man bei RTLplus bereits zwei Jahre zuvor begonnen und perfektionierte es unter Conrad. Seine Idealvorstellung war es dabei, das eigene Programm derart erwartbar zu gestalten, dass kein Blick in die Fernsehzeitschrift mehr nötig sein würde. Darum fuhr er gleichzeitig den Einsatz von Spielfilmen drastisch zurück, deren unterschiedliche Längen sein einheitliches Schema torpedierten.
 Um einen täglich nicht unterscheidbaren Ablauf gewährleisten zu können, musste Conrad Reihen etablieren, deren Herstellung derart effizient und standardisiert war, dass die Versorgung mit täglich neuen Ausgaben zu geringen Kosten gewährleistet werden konnte. Damit wurden TV-Formate erstmals nicht mehr als reine kreative Kunstobjekte betrachtet, ab jetzt waren sie Industrieware, die quasi am Fließband zu produzieren war und deren Anfertigung nie ins Stocken geraten durfte. Hier entwickelte sich das «Familienduell» mit Werner Schulze-Erdel, das im Jahr 1992 erstmals über den Schirm flimmerte, als ein Lehrstück für solche industrielle Fernsehware, da pro Produktionstag gleich mehrere Folgen am Stück aufgenommen werden konnten und die Abläufe – selbst die Sätze des Moderators - derart normiert und schematisiert waren, dass jede Einheit der anderen glich, wie ein VW Käfer dem anderen. Fließbandarbeit eben. Vorhersehbarer kann Fernsehen kaum sein.
Um einen täglich nicht unterscheidbaren Ablauf gewährleisten zu können, musste Conrad Reihen etablieren, deren Herstellung derart effizient und standardisiert war, dass die Versorgung mit täglich neuen Ausgaben zu geringen Kosten gewährleistet werden konnte. Damit wurden TV-Formate erstmals nicht mehr als reine kreative Kunstobjekte betrachtet, ab jetzt waren sie Industrieware, die quasi am Fließband zu produzieren war und deren Anfertigung nie ins Stocken geraten durfte. Hier entwickelte sich das «Familienduell» mit Werner Schulze-Erdel, das im Jahr 1992 erstmals über den Schirm flimmerte, als ein Lehrstück für solche industrielle Fernsehware, da pro Produktionstag gleich mehrere Folgen am Stück aufgenommen werden konnten und die Abläufe – selbst die Sätze des Moderators - derart normiert und schematisiert waren, dass jede Einheit der anderen glich, wie ein VW Käfer dem anderen. Fließbandarbeit eben. Vorhersehbarer kann Fernsehen kaum sein. Unter ähnlichen Produktionsbedingungen entstanden ebenso die täglichen Talkshows, die das deutsche Fernsehen für rund zwei Jahrzehnte dominierte. Deren erste Variante «Hans Meiser» mit dem gleichnamigen Nachrichtensprecher erblickte während Conrads Amtszeit im Mai 1992 das Licht der Welt. Mit ihr entstand erstmals ein fester, verlässlicher, ritualisierter und täglich wiederkehrender Rahmen für intime Einblicke in das Privatleben „einfacher“ Menschen. Ein Ansatz, den das Fernsehen bis heute exzessiv genutzt hat - egal ob bei «Frauentausch», bei «Big Brother» oder bei «Das perfekte Dinner».
Unter ähnlichen Produktionsbedingungen entstanden ebenso die täglichen Talkshows, die das deutsche Fernsehen für rund zwei Jahrzehnte dominierte. Deren erste Variante «Hans Meiser» mit dem gleichnamigen Nachrichtensprecher erblickte während Conrads Amtszeit im Mai 1992 das Licht der Welt. Mit ihr entstand erstmals ein fester, verlässlicher, ritualisierter und täglich wiederkehrender Rahmen für intime Einblicke in das Privatleben „einfacher“ Menschen. Ein Ansatz, den das Fernsehen bis heute exzessiv genutzt hat - egal ob bei «Frauentausch», bei «Big Brother» oder bei «Das perfekte Dinner». Die industrielle Produktion war jedoch nicht auf Showprojekte begrenzt, sondern fand mit der Einführung von «Gute Zeiten, Schlechte Zeiten» im selben Jahr ihr Pendant im fiktiven Bereich. Mit dieser Serie bot RTL nun jeden Abend pünktlich zum Abendbrot eine Handvoll dramatischer Geschichten an - platziert übrigens schon damals um 19.40 Uhr, also auf jenem Slot, den sie bis heute nie verloren hat. Zusammen mit dem ebenfalls neu eingeführten «Explosiv – Das Magazin» löste sie die bisher werktäglich wechselnde Jonglage der US-Serien «A-Team» (montags), «Knight Rider» (dienstags), «Zurück in die Vergangenheit» (mittwochs), «21 Jump Street» (donnerstags) sowie «Pazifikgeschwader 214» (freitags) ab und verlängerte das Stripping auf diese Weise bis in den Vorabend hinein.
Die industrielle Produktion war jedoch nicht auf Showprojekte begrenzt, sondern fand mit der Einführung von «Gute Zeiten, Schlechte Zeiten» im selben Jahr ihr Pendant im fiktiven Bereich. Mit dieser Serie bot RTL nun jeden Abend pünktlich zum Abendbrot eine Handvoll dramatischer Geschichten an - platziert übrigens schon damals um 19.40 Uhr, also auf jenem Slot, den sie bis heute nie verloren hat. Zusammen mit dem ebenfalls neu eingeführten «Explosiv – Das Magazin» löste sie die bisher werktäglich wechselnde Jonglage der US-Serien «A-Team» (montags), «Knight Rider» (dienstags), «Zurück in die Vergangenheit» (mittwochs), «21 Jump Street» (donnerstags) sowie «Pazifikgeschwader 214» (freitags) ab und verlängerte das Stripping auf diese Weise bis in den Vorabend hinein.Kein Herz für Senioren
Neben der Etablierung eines durchgehenden Flows und der Einführung eines verlässlichen Ablaufs führte Conrad zusätzlich die konsequente Orientierung an den sogenannten „Key-Demographics“ ein. Dahinter verbarg sich die heute stärker denn je betriebene Fokussierung auf eine bestimmte anvisierte Zielgruppe – mittlerweile meist der Personen in einem Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Damals konzentrierte man sich zwar noch auf die 18- bis 49-Jährigen als Kerngruppe, doch unverändert galt und gilt, das Programm soweit zu optimieren, dass bloß noch jene Personen angesprochen werden, die für die Werbewirtschaft relevant sind. Dies soll für die Werbetreibenden einen möglichst geringen Streuverlust gewährleisten, was wiederum höhere Preise für die Schaltung von Werbespots rechtfertigt. Vergleichbar mit Jugendlichen, die irgendwann beginnen, lieber etwas mit Altersgenossen zu unternehmen, als mit ihren Großeltern am Kaffeetisch zu sitzen.
 In diesem Zuge beendete Conrad zuerst Produktionen wie «Die Heimatmelodie», «Musikrevue» und «Sielmann 2000», die in seinen Augen das falsche Publikum anlockten. Darüber hinaus mussten die beliebten Gameshows «Riskant» und «Der Preis ist heiß» ihren langjährigen Platz am Vorabend räumen und auf den Vormittag um 10.30 Uhr umziehen. „Nicht weil sie schlechte Zahlen hätten“, wie Conrad in einem viel zitierten Interview mit dem Fachblatt Funkkorrespondenz versicherte, „ich verlege sie, weil ihre Zuschauer mir insgesamt zu alt sind.“ Ihren Platz um 17.00 Uhr nahmen tägliche Ausstrahlungen der US-Sitcoms «Wer ist hier der Boss?» und «Eine schrecklich nette Familie» ein, die zwar weniger Menschen erreichten, aber „die Leute, die uns sehen, die passen dann viel besser in die von uns angepeilten ‚Key-Demographics‘ hinein.“
In diesem Zuge beendete Conrad zuerst Produktionen wie «Die Heimatmelodie», «Musikrevue» und «Sielmann 2000», die in seinen Augen das falsche Publikum anlockten. Darüber hinaus mussten die beliebten Gameshows «Riskant» und «Der Preis ist heiß» ihren langjährigen Platz am Vorabend räumen und auf den Vormittag um 10.30 Uhr umziehen. „Nicht weil sie schlechte Zahlen hätten“, wie Conrad in einem viel zitierten Interview mit dem Fachblatt Funkkorrespondenz versicherte, „ich verlege sie, weil ihre Zuschauer mir insgesamt zu alt sind.“ Ihren Platz um 17.00 Uhr nahmen tägliche Ausstrahlungen der US-Sitcoms «Wer ist hier der Boss?» und «Eine schrecklich nette Familie» ein, die zwar weniger Menschen erreichten, aber „die Leute, die uns sehen, die passen dann viel besser in die von uns angepeilten ‚Key-Demographics‘ hinein.“  Ein weiterer zentraler Baustein in Conrads Strategie bildete das ebenfalls im Jahr 1992 neu eingeführte «Gottschalk Late Night», welches allein deswegen als bahnbrechend galt, weil es die erste Nachtshow nach amerikanischem Vorbild im deutschen Fernsehen war und selbst den späten Platz um 23.00 Uhr noch mit neuer Ware und bekannten Gesichtern bespielte. Wichtiger für Conrad war aber die Tatsache, dass es durch sie gelang, eine verlässliche werktägliche Programmierung auch am späten Abend zu gewährleisten. Zugleich stellte sie sich als „Bombengeschäft“ heraus, wie Conrad bestätigte: „Da sitzt nicht zufällig ein für die Werbekunden um diese Zeit ja uninteressanter Opa vor dem Bildschirm, nur weil er Schlafstörungen hat, sondern wir erreichen praktisch hundertprozentig Zuschauer aus der Zielgruppe, die uns und die Werbekunden auch interessiert.“ Deshalb wäre ihm diese Reihe lieber gewesen, als die vorher auf diesem Slot gezeigten Sexfilmchen, die zwar insgesamt ein paar hunderttausend Zuschauende mehr erreichten, aber einen viel größeren Streuverlust hatten.
Ein weiterer zentraler Baustein in Conrads Strategie bildete das ebenfalls im Jahr 1992 neu eingeführte «Gottschalk Late Night», welches allein deswegen als bahnbrechend galt, weil es die erste Nachtshow nach amerikanischem Vorbild im deutschen Fernsehen war und selbst den späten Platz um 23.00 Uhr noch mit neuer Ware und bekannten Gesichtern bespielte. Wichtiger für Conrad war aber die Tatsache, dass es durch sie gelang, eine verlässliche werktägliche Programmierung auch am späten Abend zu gewährleisten. Zugleich stellte sie sich als „Bombengeschäft“ heraus, wie Conrad bestätigte: „Da sitzt nicht zufällig ein für die Werbekunden um diese Zeit ja uninteressanter Opa vor dem Bildschirm, nur weil er Schlafstörungen hat, sondern wir erreichen praktisch hundertprozentig Zuschauer aus der Zielgruppe, die uns und die Werbekunden auch interessiert.“ Deshalb wäre ihm diese Reihe lieber gewesen, als die vorher auf diesem Slot gezeigten Sexfilmchen, die zwar insgesamt ein paar hunderttausend Zuschauende mehr erreichten, aber einen viel größeren Streuverlust hatten.Ein großer Haufen
Die von Conrad angestoßenen Veränderungen und Maßnahmen zeigten schnell Erfolg, sodass der Kanal am Ende des Jahres erstmals die Marktführerschaft in der jungen Zielgruppe übernehmen und diese jahrzehntelang behalten konnte. Dies ging an der Konkurrenz nicht unbemerkt vorbei, die (egal ob privat oder öffentlich-rechtlich) begann, diese Prinzipien zu kopieren, weswegen sich das gesamte deutschsprachige Angebot innerhalb kürzester Zeit aneinander angleichte.
 Um diese marktbeherrschende Position künftig halten zu können, so war sich Conrad sicher, war es für RTLplus nötig, die Nachrichten auszubauen: „Man kann nämlich nur die Marktführerschaft mit dem gesamten Sender halten, wenn man auch auf dem Nachrichtensektor die Nummer 1 ist und ernst genommen wird.“ Als Erwachsener muss man sich eben mit Politik befassen. Deshalb begann Conrad, seine Nachrichten kontinuierlich auszubauen, aufzuwerten und zu einer vertrauenswürdigen Marke zu bündeln. Dazu gehörte neben der einheitlichen Gestaltung der existierenden Ausgaben deren Ergänzung um ein Mittagsmagazin, welches ab 1992 zunächst unter dem Titel «Zwölfdreißig» startete. Ab Juni wanderte es eine halbe Stunde nach vorn und erhielt den nach wie vor gültigen Namen «Punkt 12». Zeitgleich erfuhr der bisherige Redakteur Peter Kloeppel seine Beförderung zum Hauptnachrichtensprecher und stieg zum bis heute vielleicht wichtigsten Gesicht des Unternehmens auf.
Um diese marktbeherrschende Position künftig halten zu können, so war sich Conrad sicher, war es für RTLplus nötig, die Nachrichten auszubauen: „Man kann nämlich nur die Marktführerschaft mit dem gesamten Sender halten, wenn man auch auf dem Nachrichtensektor die Nummer 1 ist und ernst genommen wird.“ Als Erwachsener muss man sich eben mit Politik befassen. Deshalb begann Conrad, seine Nachrichten kontinuierlich auszubauen, aufzuwerten und zu einer vertrauenswürdigen Marke zu bündeln. Dazu gehörte neben der einheitlichen Gestaltung der existierenden Ausgaben deren Ergänzung um ein Mittagsmagazin, welches ab 1992 zunächst unter dem Titel «Zwölfdreißig» startete. Ab Juni wanderte es eine halbe Stunde nach vorn und erhielt den nach wie vor gültigen Namen «Punkt 12». Zeitgleich erfuhr der bisherige Redakteur Peter Kloeppel seine Beförderung zum Hauptnachrichtensprecher und stieg zum bis heute vielleicht wichtigsten Gesicht des Unternehmens auf.Angesichts all dieser Schritte wird deutlich, in welche Richtung der Wandel von RTLplus ging. Ab dem Jahr 1992 standen fortan weniger Spaß und Spielfreude, als vielmehr betriebswirtschaftliche Überlegungen im Vordergrund. Die Zeit des freien Ausprobierens und unbeschwerten Experimentierens war unwiderruflich vorbei. Ab jetzt war Fernsehen durch und durch ein Geschäft. Ein Geschäft wie es typischerweise eher Erwachsene und weniger Kinder betreiben. Und es war (im wahrsten Sinne des Wortes) kein kleines Geschäft, weil es um einen sehr großen Haufen Geld ging. Schließlich prognostizierte Helmut Thoma im Sommer 1992 auf dem Medienforum für das laufende Jahr einen Netto-Umsatz von 1,9 Mrd. DM. Ein absoluter Rekordwert, der so enorm war, dass die Branche allein seinetwegen ihre kindliche Naivität ablegte.
Der letzte Schliff…
 Nur eines fehlte zur vollständigen Abnabelung - noch immer galt der Fernsehsender als Anhängsel (oder Nachkomme) des Radioprogramms, aus dem er ursprünglich hervorgegangen war. Deutlich wurde dies darin, dass der TV-Ableger den Zusatz „plus“ im Namen trug. Dieser degradierte das Haus quasi zu einem RTL Junior. Das aber war angesichts dieser beeindruckenden Bilanz längst überholt, was Conrad dringend nach außen zum Ausdruck bringen wollte. Nach einjährigen Verhandlungen mit dem Mutterkonzern erreichte er endlich, dass ab dem 01. November 1992 der ungeliebte Anhang gestrichen werden konnte.
Nur eines fehlte zur vollständigen Abnabelung - noch immer galt der Fernsehsender als Anhängsel (oder Nachkomme) des Radioprogramms, aus dem er ursprünglich hervorgegangen war. Deutlich wurde dies darin, dass der TV-Ableger den Zusatz „plus“ im Namen trug. Dieser degradierte das Haus quasi zu einem RTL Junior. Das aber war angesichts dieser beeindruckenden Bilanz längst überholt, was Conrad dringend nach außen zum Ausdruck bringen wollte. Nach einjährigen Verhandlungen mit dem Mutterkonzern erreichte er endlich, dass ab dem 01. November 1992 der ungeliebte Anhang gestrichen werden konnte. Damit einher ging die Ablösung des alten Logos, welches Conrad ebenso ein Dorn im Auge war: „Versuchen Sie dieses alte RTL-plus-Logo mal nachzuzeichnen“, beschwerte er sich damals im Interview. „Sie werden es nicht schaffen.“ Gemeint war jenes Logo, bei dem sich die drei Haus-Buchstaben an ihren jeweiligen Rücken trafen und eine Art Fächer bildeten. „Das Ganze erinnerte eher an ein aufgeschlagenes Buch als an ein Logo für einen Fernsehsender“, beschrieb es rückblickend die Literaturwissenschaftlerin Christina Scherer. Der Buchstaben-Fächer wich letztlich dem bis heute genutzten aus drei Rechtecken bestehenden Markenzeichen.
Damit einher ging die Ablösung des alten Logos, welches Conrad ebenso ein Dorn im Auge war: „Versuchen Sie dieses alte RTL-plus-Logo mal nachzuzeichnen“, beschwerte er sich damals im Interview. „Sie werden es nicht schaffen.“ Gemeint war jenes Logo, bei dem sich die drei Haus-Buchstaben an ihren jeweiligen Rücken trafen und eine Art Fächer bildeten. „Das Ganze erinnerte eher an ein aufgeschlagenes Buch als an ein Logo für einen Fernsehsender“, beschrieb es rückblickend die Literaturwissenschaftlerin Christina Scherer. Der Buchstaben-Fächer wich letztlich dem bis heute genutzten aus drei Rechtecken bestehenden Markenzeichen. An jenem Tag, als RTL nach umfangreichen Umgestaltungen sein neuen Look der Welt präsentierte, trat es sowohl inhaltlich als auch visuell aus dem Schatten seiner piefigen Radiovergangenheit heraus und ebnete seinen eigenen erfolgsversprechenden Weg. Einen Weg, dem all die anderen Privatsender beeindruckt folgten. An jenem 01. November des Jahres 1992, dem Tag, als RTL sein „plus“ verlor, wurde aus dem jugendlichen Draufgänger eine geschäftstüchtige, berechnende und unabhängige Person. An diesem Tag wurde RTL und mit ihm das ganze deutsche Privatfernsehen endgültig erwachsen.
Seine Blütezeit sollte allerdings nur knapp vier Jahre betragen, denn am 09. Dezember 1995 war es bereits an seinem Zenit angekommen, wie hier nachzulesen ist. Marc Conrad blieb derweil bis 1999 Programmdirektor und verließ den Konzern zusammen mit seinem einstigen Mentor Helmut Thoma. Vollständig löste er sich von seiner alten Heimat dabei nicht, steuerte seine Firma Typhoon doch dann zahlreiche TV-Movies sowie die Shows «Freitag Nacht News», «Mein Morgen» und «Dritte Halbzeit» zum Portfolio des Hauses zu. Im Jahr 2004 kehrte er schließlich als Geschäftsführer zurück, behielt diesen Posten jedoch lediglich ein Vierteljahr. Zu diesem Zeitpunkt war sein früheres Glanzstück aber längst in eine lähmende Routine verfallen.
Die nächste Ausgabe des Fernsehfriedhofs erscheint am Donnerstag, den 11. Mai 2017 und widmet sich dann sieben vergessenen Shows, in denen man Millionär werden konnte.
27.04.2017 11:03 Uhr
• Christian Richter
Kurz-URL: qmde.de/92688
