
Die cineastische Rückkehr nach Mittelerde
Der Film des Monats: Mit «Der Hobbit – Eine unerwartete Reise» beginnt Peter Jacksons zweite Mittelerde-Trilogie. Reicht Bilbo Beutlins Abenteuer an «Der Herr der Ringe» heran oder hat sich Jackson übernommen?
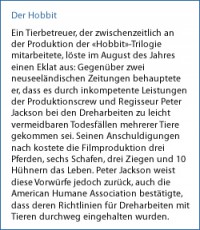 Der immense Erfolg von Peter Jacksons «Der Herr der Ringe»-Trilogie löste (gemeinsam mit den ebenfalls populären «Harry Potter»-Filmen) eine Welle an Fantasyfilmen aus. Diese standen jedoch sowohl an den Kinokassen als auch bei den Filmkritikern durchweg im Schatten der Tolkien-Verfilmungen. Fans hungerten nach mehr, sogar nach Veröffentlichung der Extended Editions mit rund zwölf Stunden Filmlaufzeit und ausschweifendem Bonusmaterial – und auch die Rechteinhaber hatten nichts gegen einen weiteren sicheren Hit auszusetzen. Eine Adaption von J. R. R. Tolkiens jugendorientiertem Fantasybuch «Der kleine Hobbit» war da eine Selbstverständlichkeit. Dass es dennoch fast ein Jahrzehnt dauerte, bis Kinogänger nach Mittelerde zurückkehren konnten, war einer Vielzahl an Problemen geschuldet. Dazu zählten unter anderem ein langwieriger Streit um die Filmrechte, eine rechtliche Auseinandersetzung zwischen Wunschregisseur Peter Jackson und dem Studio New Line Cinema sowie Finanzprobleme der Produktionsfirma MGM. Zumindest quantitativ machte sich die Geduld der Fans bezahlt: Über gleich drei Filme erstreckt sich Bilbo Beutlins unerwartetes Abenteuer. Doch wäre weniger vielleicht mehr gewesen?
Der immense Erfolg von Peter Jacksons «Der Herr der Ringe»-Trilogie löste (gemeinsam mit den ebenfalls populären «Harry Potter»-Filmen) eine Welle an Fantasyfilmen aus. Diese standen jedoch sowohl an den Kinokassen als auch bei den Filmkritikern durchweg im Schatten der Tolkien-Verfilmungen. Fans hungerten nach mehr, sogar nach Veröffentlichung der Extended Editions mit rund zwölf Stunden Filmlaufzeit und ausschweifendem Bonusmaterial – und auch die Rechteinhaber hatten nichts gegen einen weiteren sicheren Hit auszusetzen. Eine Adaption von J. R. R. Tolkiens jugendorientiertem Fantasybuch «Der kleine Hobbit» war da eine Selbstverständlichkeit. Dass es dennoch fast ein Jahrzehnt dauerte, bis Kinogänger nach Mittelerde zurückkehren konnten, war einer Vielzahl an Problemen geschuldet. Dazu zählten unter anderem ein langwieriger Streit um die Filmrechte, eine rechtliche Auseinandersetzung zwischen Wunschregisseur Peter Jackson und dem Studio New Line Cinema sowie Finanzprobleme der Produktionsfirma MGM. Zumindest quantitativ machte sich die Geduld der Fans bezahlt: Über gleich drei Filme erstreckt sich Bilbo Beutlins unerwartetes Abenteuer. Doch wäre weniger vielleicht mehr gewesen?In einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit
 Rund 60 Jahre vor den Ereignissen von «Der Herr der Ringe – Die Gefährten» suchte sich der graue Zauberer Gandalf (Ian McKellen) den gemütlichen, seine Heimat liebenden Hobbit Bilbo Beutlin (Martin Freeman) aus, um ihn und eine Gruppe von 13 Zwergen bei einem aufregenden Abenteuer zu begleiten. Das Zwergevolk wurde einst vom Drachen Smaug aus seiner wohlhabenden und prachtvollen Heimat Erebor vertrieben und zieht seither durch Mittelerde, ohne sich je an einen Ort zu binden. Die vom legendären Krieger Thorin Eichenschild (Richard Armitage) angeführte Zwergentruppe hat es sich zum Ziel gesetzt, dem ein Ende zu bereiten, benötigt dazu aber jemanden, der flink ist und einer dem Drachen Smaug unbekannten Art angehört – einen Hobbit. Und auch wenn sich Bilbo anfangs sträubt, sich Gandalf und den lärmenden Zwergen anzuschließen, hat der weise Zauberer die richtige Wahl getroffen: Tief, tief in diesem Hobbit schlummert genügend Fernweh, um seine ruhige Heimat zu verlassen. Seiner Aufgabe wird er allerdings vorerst nicht gerecht, was ihm das Misstrauen Thorins einbringt. Doch den kleinen Hobbit erwartet nicht nur bloße Ablehnung auf seiner wundersamen Reise, sondern obendrein eine Vielzahl an ungeahnten Gefahren ...
Rund 60 Jahre vor den Ereignissen von «Der Herr der Ringe – Die Gefährten» suchte sich der graue Zauberer Gandalf (Ian McKellen) den gemütlichen, seine Heimat liebenden Hobbit Bilbo Beutlin (Martin Freeman) aus, um ihn und eine Gruppe von 13 Zwergen bei einem aufregenden Abenteuer zu begleiten. Das Zwergevolk wurde einst vom Drachen Smaug aus seiner wohlhabenden und prachtvollen Heimat Erebor vertrieben und zieht seither durch Mittelerde, ohne sich je an einen Ort zu binden. Die vom legendären Krieger Thorin Eichenschild (Richard Armitage) angeführte Zwergentruppe hat es sich zum Ziel gesetzt, dem ein Ende zu bereiten, benötigt dazu aber jemanden, der flink ist und einer dem Drachen Smaug unbekannten Art angehört – einen Hobbit. Und auch wenn sich Bilbo anfangs sträubt, sich Gandalf und den lärmenden Zwergen anzuschließen, hat der weise Zauberer die richtige Wahl getroffen: Tief, tief in diesem Hobbit schlummert genügend Fernweh, um seine ruhige Heimat zu verlassen. Seiner Aufgabe wird er allerdings vorerst nicht gerecht, was ihm das Misstrauen Thorins einbringt. Doch den kleinen Hobbit erwartet nicht nur bloße Ablehnung auf seiner wundersamen Reise, sondern obendrein eine Vielzahl an ungeahnten Gefahren ...Vom charmanten Vorgänger zur gigantischen Prequel-Trilogie
Während Tolkien Bilbo Beutlins Geschichte vor seinem Magnum Opus verfasste, kommt die Filmversion als Prequel-Trilogie daher, was sich auch auf den Erzählstil auswirkt. Spielt das Buch schlicht im «Der Herr der Ringe»-Universum und etablierte vorab einige der Figuren, bemüht sich Peter Jackson intensiv um Querverweise zwischen beiden Trilogien. Somit eröffnet «Der Hobbit – Eine unerwartete Reise» sogleich mit einem doppelten Prolog. Wird zunächst, ähnlich wie in «Der Herr der Ringe – Die Gefährten», die Vorgeschichte erläutert, spannt anschließend ein neuer Prolog einen klaren Bogen zum ersten Akt von «Die Gefährten». Auf die eigentliche Geschichte haben die Sequenzen mit dem gealterten Bilbo Beutlin (Ian Holm) keinerlei Einfluss, allerdings sind sie ein charmanter Rahmen, der beide Filmreihen stilistisch vereint. Diese Aufgabe erfüllt der Prolog rasch und effektiv – woraufhin er noch einige Minuten weiterläuft. Womit auch der Hauptunterschied zwischen den Trilogie-Eröffnungsfilmen bewusst wird.
Ob in der Kinofassung oder der Extended Edition, trotz einer stattlichen Laufzeit von 178 beziehungsweise 228 Minuten verfügt «Der Herr der Ringe – Die Gefährten» über keine überschüssigen Filmmomente. Jede Minute formt die Handlung, die Figurenzeichnung oder die Mythologie aus, so dass sich der Film nicht zieht, obwohl er zwischenzeitlich nur über eine geringe, den Spannungsbogen stützende Dringlichkeit verfügt. Dem Beginn der Prequel-Trilogie mangelt es noch stärker an Momentum, ob die Zwerge zügig vorwärtskommen oder sich ihr Streifzug verzögert, ist im Grunde unbedeutend. Das wäre nicht so störend, spiele Peter Jackson nicht sämtliche Sequenzen möglichst weit durch, im Versuch, ihnen die Tragweite von «Der Herr der Ringe» zu verleihen.
 Zwar ereilt den Kinogänger im 169-minütigen «Der Hobbit – Eine unerwartete Reise» nicht so viel Zeitschinderei, wie man befürchten könnte, dennoch sind einige Sequenzen deutlich ausführlicher als nötig. Für sich betrachtet sind sie nicht langweilig, als Gesamtwerk fühlt sich Jacksons Rückkehr nach Mittelerde aufgrund des fehlenden Schwungs aber deutlich länger an als die bisherigen Tolkien-Verfilmungen des neuseeländischen Regisseurs. Womöglich unnötigster Teil von Bilbos unerwarteter Reise ist eine Begegnung mit drei dümmlichen Trollen, von der «Der Herr der Ringe»-Kenner bereits wissen. Diese im Vorbeilaufen ausgesprochene Anekdote aus «Der Herr der Ringe – Die Gefährten» wird in diesem Film zu einer zirka 15-minütigen Sequenz ausgebreitet, die auf die Hälfte der Zeit runtergekürzt wesentlich griffiger und charismatischer gewesen wäre.
Zwar ereilt den Kinogänger im 169-minütigen «Der Hobbit – Eine unerwartete Reise» nicht so viel Zeitschinderei, wie man befürchten könnte, dennoch sind einige Sequenzen deutlich ausführlicher als nötig. Für sich betrachtet sind sie nicht langweilig, als Gesamtwerk fühlt sich Jacksons Rückkehr nach Mittelerde aufgrund des fehlenden Schwungs aber deutlich länger an als die bisherigen Tolkien-Verfilmungen des neuseeländischen Regisseurs. Womöglich unnötigster Teil von Bilbos unerwarteter Reise ist eine Begegnung mit drei dümmlichen Trollen, von der «Der Herr der Ringe»-Kenner bereits wissen. Diese im Vorbeilaufen ausgesprochene Anekdote aus «Der Herr der Ringe – Die Gefährten» wird in diesem Film zu einer zirka 15-minütigen Sequenz ausgebreitet, die auf die Hälfte der Zeit runtergekürzt wesentlich griffiger und charismatischer gewesen wäre.Der Versuch, das Hobbit-Abenteuer an die Filmtrilogie anzupassen, führt zudem zu einer tonalen Verschiebung: Ist die Buchvorlage naiver, kindlicher und unschuldig-magischer als «Der Herr der Ringe», bringen Peter Jackson und seine drei Co-Autoren Fran Walsh, Philippa Boyens und Guillermo del Toro in kleinen Dosen etwas von der Epik und Dramatik der erfolgreichen Filmtrilogie in «Der Hobbit – Eine unerwartete Reise» ein. Das hat den Vorteil, dass Gandalfs Rolle nicht der wandelnde „Deus Ex Machina“ der Buchvorlage ist und viele Einzelheiten fundierter etabliert werden, auf der nachteiligen Seite überspannen Jackson und Co. aber die kleine Geschichte und riskieren vereinzelte Brüche zwischen der gewaltigen Darstellung und dem vergleichsweise gemütlicheren Inhalt.
Kleiner Inhalt, große Pracht
 Trotz Überlänge erreichen Bilbo, Gandalf und die Zwerge erschreckend wenig im Laufe des Films, doch dieses Bisschen an inhaltlichem Fortschritt sieht wundervoll aus und klingt genauso gut. Die Sets sind so liebevoll gestaltet, wie man es von der «Der Herr der Ringe»-Trilogie kennt und wieder einmal werden viele das Kino mit dem Wunsch nach Urlaub in Neuseeland verlassen, so atemberaubend schön sind Andrew Lesnies Landschaftsaufnahmen. Die Actionszenen sind einfallsreich choreographiert und der Mangel an Brisanz wird durch einen übersichtlicheren Schnitt gut ausgeglichen. Von wenigen Ausnahmen, in denen das Shading nicht vor Produktionsende nicht fertig geworden zu sein scheint, sind die Computereffekte eindrucksvoll und fügen sich nahtlos in die Miniaturen und realen Bilder ein.
Trotz Überlänge erreichen Bilbo, Gandalf und die Zwerge erschreckend wenig im Laufe des Films, doch dieses Bisschen an inhaltlichem Fortschritt sieht wundervoll aus und klingt genauso gut. Die Sets sind so liebevoll gestaltet, wie man es von der «Der Herr der Ringe»-Trilogie kennt und wieder einmal werden viele das Kino mit dem Wunsch nach Urlaub in Neuseeland verlassen, so atemberaubend schön sind Andrew Lesnies Landschaftsaufnahmen. Die Actionszenen sind einfallsreich choreographiert und der Mangel an Brisanz wird durch einen übersichtlicheren Schnitt gut ausgeglichen. Von wenigen Ausnahmen, in denen das Shading nicht vor Produktionsende nicht fertig geworden zu sein scheint, sind die Computereffekte eindrucksvoll und fügen sich nahtlos in die Miniaturen und realen Bilder ein. Störend fällt derweil auf, dass die Ungeheuer in Mittelerde simpler gestaltet sind und häufiger dem Computer entspringen als noch in «Der Herr der Ringe». Umso beeindruckender ist, dass Gollum, der das letzte Viertel des Films völlig an sich reißt, mit noch feinerer Mimik daherkommt. Darstellerisch sind der mittels Computermagie in Gollum verwandelte Andy Serkis und Ian McKellen die Gewinner dieses Films, aber auch Martin Freeman verleiht seiner Rolle feine Facetten. Er adaptiert Ian Holms Gestik, macht Bilbo Beutlin aber dessen ungeachtet zu seiner eigenen Figur und trägt Stück für Stück nonverbal die Figurenentwicklung des Hobbits vorwärts, wodurch er glaubwürdig vom langweiligen Faulenzer zum fähigen (nicht übertrieben mutigen) Abenteurer, vorwärts.
Gegenüber der «Der Herr der Ringe»-Trilogie sind die restlichen Nebenfiguren derweil etwas flacher und blasser geraten. Komponist Howard Shore indes adaptiert vereinzelte Themen aus der vielfach Oscar-prämierten Trilogie und mischt frische Melodien darunter, von denen das Zwegen-Leitmotiv am denkwürdigsten ist. Das aus dem ersten Trailer bekannte, eingängige Lied, das instrumental mehrfach wiederverwertet wird und auch im Abspann zu hören ist, vereint die Hoffnung sowie die Verzweiflung der Abenteurergruppe in simplen, aber gefühlvollen Noten, womit es einen großartigen musikalischen Aufhänger für die «Hobbit»-Trilogie darstellt.
Eine Sage in 48 Bildern pro Sekunde
 Mit der «Der Herr der Ringe»-Trilogie verdiente sich Peter Jackson einen Ehrenplatz in der Filmgeschichte, weil er einen Meilenstein der Fantasyliteratur handwerklich nahezu perfekt auf die Leinwand brachte. Auch «Der Hobbit – Eine unerwartete Reise» schickt sich an, in die cineastischen Geschichtsbücher einzugehen, dieses Mal jedoch aufgrund einer heiß diskutierten, technischen Neuerung. Peter Jacksons Epos ist der erste große Film, der nicht in der üblichen Bildrate von 24 Bildern pro Sekunde gedreht wurde, sondern mit 48 Bildern pro Sekunde. Ausgewählte Kinos führen die Mammutproduktion auch in dieser höheren Bildrate vor (sowie in 3D), und somit ist der Grundstein für eine Publikumsdebatte gelegt, die so harsche Züge annehmen könnte, dass sie selbst die ewige Pro- oder Anti-3D-Diskussion in den Schatten stellt.
Mit der «Der Herr der Ringe»-Trilogie verdiente sich Peter Jackson einen Ehrenplatz in der Filmgeschichte, weil er einen Meilenstein der Fantasyliteratur handwerklich nahezu perfekt auf die Leinwand brachte. Auch «Der Hobbit – Eine unerwartete Reise» schickt sich an, in die cineastischen Geschichtsbücher einzugehen, dieses Mal jedoch aufgrund einer heiß diskutierten, technischen Neuerung. Peter Jacksons Epos ist der erste große Film, der nicht in der üblichen Bildrate von 24 Bildern pro Sekunde gedreht wurde, sondern mit 48 Bildern pro Sekunde. Ausgewählte Kinos führen die Mammutproduktion auch in dieser höheren Bildrate vor (sowie in 3D), und somit ist der Grundstein für eine Publikumsdebatte gelegt, die so harsche Züge annehmen könnte, dass sie selbst die ewige Pro- oder Anti-3D-Diskussion in den Schatten stellt. Peter Jacksons Intention hinter seinem revolutionären Schritt hin zu 48 FPS ist folgende: Durch die größere Bildinformation werden künstliche Flackereffekte minimiert, außerdem sollen Details sowie Bewegungen klarer erscheinen als im Kino gewohnt. Darüber hinaus beabsichtigt Jackson mit der höheren Bildrate, der von einigen Kinogängern abgelehnten 3D-Technik Abhilfe zu schaffen. Dass manche Menschen von 3D-Filmen Kopfschmerzen bekommen, liegt teils an der für sie schwer zu verarbeitenden Diskrepanz zwischen der real erscheinenden Bildtiefe und den unrealistischen, da auf 24 Bildinformationen die Sekunde beschränkten, Bewegungen. Mit 48 Bildern pro Sekunde intensiviere sich der Realismus der 3D-Illusion. „3D zeigt einem ein Fenster in eine andere Welt, die höhere Bildrate entfernt das Fensterglas. Es ist praktisch die Realität“, feiert etwa James Cameron die fortschrittliche Technologie, weshalb er seine «Avatar»-Fortsetzungen ebenfalls mit erhöhter Bildrate drehen will.
 Tatsächlich strahlt «Der Hobbit – Eine unerwartete Reise» im so genannten HFR 3D in einer nie zuvor dagewesenen Klarheit. Einzelne Bilder erscheinen zum Greifen nah und sofern es die Kameraführung und der Schnitt gestatten, kann man selbst feinste Details im Hintergrund genau begutachten. Gleichwohl steigert es in anderen Szenen, entgegen der ursprünglichen Absichten Jacksons, die Künstlichkeit des Films. Schnelle Kamerafahrten, ganz gleich ob über echte Landschaften oder CG-Bilder geschwenkt wird, erinnern durch ihre ungewohnte, das gesamte Leinwandbild umfassenden Schärfe eher an Miniaturen oder an Videospiel-Zwischensequenzen. In hellen Szenen wird leichter ersichtlich, dass es sich bei der Hobbit-Inneneinrichtung um Requisiten handelt oder dass die Zwerge falsche Bärte tragen. Teils fühlen sich kleinste Bewegungen unnatürlich an, als wäre nicht die Bildrate doppelt so schnell, sondern als würde der Filmvorführer den Film doppelt so schnell vorführen. Wenn eine Multi-Millionen-Dollar-Produktion, hinter der meisterliche Handwerkskünstler stecken, wie eine in HD ausgestrahlte, doch nur mittelklassiges Bühnenbild bietende TV-Produktion wirkt, so ist dies ein klarer Verlust. Andererseits sind Nahaufnahmen der Mimen eindrucksvoller denn je. Wenn Ian McKellens Gesicht die gesamte Leinwand füllt, so verkörpert der Oscar-prämierte Mime Gandalf nun selbst mit dem kleinsten Fältchen und in 48 FPS ist Gollum lebensechter denn je.
Tatsächlich strahlt «Der Hobbit – Eine unerwartete Reise» im so genannten HFR 3D in einer nie zuvor dagewesenen Klarheit. Einzelne Bilder erscheinen zum Greifen nah und sofern es die Kameraführung und der Schnitt gestatten, kann man selbst feinste Details im Hintergrund genau begutachten. Gleichwohl steigert es in anderen Szenen, entgegen der ursprünglichen Absichten Jacksons, die Künstlichkeit des Films. Schnelle Kamerafahrten, ganz gleich ob über echte Landschaften oder CG-Bilder geschwenkt wird, erinnern durch ihre ungewohnte, das gesamte Leinwandbild umfassenden Schärfe eher an Miniaturen oder an Videospiel-Zwischensequenzen. In hellen Szenen wird leichter ersichtlich, dass es sich bei der Hobbit-Inneneinrichtung um Requisiten handelt oder dass die Zwerge falsche Bärte tragen. Teils fühlen sich kleinste Bewegungen unnatürlich an, als wäre nicht die Bildrate doppelt so schnell, sondern als würde der Filmvorführer den Film doppelt so schnell vorführen. Wenn eine Multi-Millionen-Dollar-Produktion, hinter der meisterliche Handwerkskünstler stecken, wie eine in HD ausgestrahlte, doch nur mittelklassiges Bühnenbild bietende TV-Produktion wirkt, so ist dies ein klarer Verlust. Andererseits sind Nahaufnahmen der Mimen eindrucksvoller denn je. Wenn Ian McKellens Gesicht die gesamte Leinwand füllt, so verkörpert der Oscar-prämierte Mime Gandalf nun selbst mit dem kleinsten Fältchen und in 48 FPS ist Gollum lebensechter denn je. Generell lässt sich bei 48 FPS festhalten, dass es zunächst befremdlich ist und einen (je nachdem, wie sehr man darauf achtet) bewusst oder unterbewusst aus dem Film reißt. Mit etwas Eingewöhnungszeit lässt sich das Seherlebnis leichter genießen – ob die 48 FPS dann zu einer guten Sache wird, bleibt wohl Geschmackssache und wird gewiss noch lange polarisieren.
Ein unerwartetes Fazit?
«Der Hobbit – Eine unerwartete Reise» sieht prächtig aus, die Musik ist tragend und gefühlvoll und Mittelerde ist so faszinierend wie eh und je. Die zentralen Darsteller füllen das Abenteuer mit Charakter, jedoch fehlt es dem in den Actionmomenten beeindruckendem Film aufgrund seiner gedehnten Dramaturgie an Spannung und Dringlichkeit. Als «Der Herr der Ringe»-Erweiterung funktioniert dieser neue Trilogiebeginn definitiv, aber die bemühte Nachahmung des «Der Herr der Ringe»-Erfolgsrezept drosselt die Magie und Dynamik des Stoffes.
11.12.2012 10:30 Uhr
• Sidney Schering
Kurz-URL: qmde.de/60878
