
Buchclub: ‚Tausend Aufbrüche‘
Wie die Deutschen seit den 1980er-Jahren um ihre Demokratie ringen – und warum das bis heute wirkt erklärt Christina Morina.
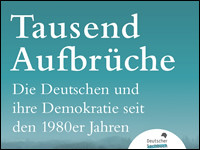 Es gibt Bücher, die erscheinen zur richtigen Zeit. Christina Morinas „Tausend Aufbrüche: Die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er-Jahren“, ausgezeichnet mit dem Deutschen Sachbuchpreis 2024, gehört zweifellos dazu. In einer Phase, in der Demokratien weltweit unter Druck stehen, in der auch in Deutschland das Vertrauen in Institutionen bröckelt und der Aufstieg des Rechtspopulismus die politische Landschaft verändert, legt Morina eine gründliche, differenzierte und zugleich zugängliche Studie vor. Sie fragt nicht abstrakt nach „der“ Demokratie, sondern untersucht, wie ganz normale Bürgerinnen und Bürger in Ost und West über Demokratie dachten, schrieben und stritten.
Es gibt Bücher, die erscheinen zur richtigen Zeit. Christina Morinas „Tausend Aufbrüche: Die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er-Jahren“, ausgezeichnet mit dem Deutschen Sachbuchpreis 2024, gehört zweifellos dazu. In einer Phase, in der Demokratien weltweit unter Druck stehen, in der auch in Deutschland das Vertrauen in Institutionen bröckelt und der Aufstieg des Rechtspopulismus die politische Landschaft verändert, legt Morina eine gründliche, differenzierte und zugleich zugängliche Studie vor. Sie fragt nicht abstrakt nach „der“ Demokratie, sondern untersucht, wie ganz normale Bürgerinnen und Bürger in Ost und West über Demokratie dachten, schrieben und stritten.Morinas Buch hebt sich von vielen Standardwerken ab, weil es nicht die große Politik in den Mittelpunkt stellt, sondern die Perspektive der Bevölkerung. Sie greift auf bisher kaum beachtete Quellen zurück: Bürgerbriefe an Parteien und Ministerien, Petitionen, Flugblätter, Leserbriefe, private Aufzeichnungen. Damit gelingt ihr ein Perspektivwechsel – weg von den Eliten, hin zu den Erfahrungen, Hoffnungen und Frustrationen der Menschen, die in beiden deutschen Staaten lebten.
Diese Selbstzeugnisse zeigen, dass Demokratie nicht nur eine institutionelle Ordnung ist, sondern ein gelebtes, oft widersprüchliches Alltagsverständnis. Menschen in der Bundesrepublik diskutierten in den 1980er-Jahren zum Beispiel über Umweltschutz, Friedensbewegung oder Fragen der sozialen Gerechtigkeit, während Bürgerinnen und Bürger in der DDR immer wieder Forderungen nach Mitbestimmung, Transparenz und Rechtsstaatlichkeit formulierten – trotz oder gerade wegen der Beschränkungen, denen sie unterlagen.
Morina gelingt es, die Demokratiegeschichte der Bundesrepublik und die Demokratieanspruchsgeschichte der DDR miteinander zu verzahnen. Sie zeigt, wie unterschiedlich das Verständnis von Politik und Staat war – und wie sich diese Unterschiede nach 1990 weiter auswirkten. In der DDR existierte ein ausgeprägter provinziell-utopischer Bürgersinn: Viele Menschen identifizierten sich mit ihrem Land, glaubten aber nicht an die Glaubwürdigkeit der Institutionen. Es gab ein Ideal von „volksdemokratischer“ Mitbestimmung, aber gleichzeitig eine tiefe Skepsis gegenüber den realen Machtstrukturen. Diese Staatsferne hat sich nach der Vereinigung in einer ambivalenten Haltung fortgesetzt – zwischen Gestaltungswillen und Enttäuschung.
Im Westen wiederum beschreibt Morina, wie die Liberalisierung und Pluralisierung der Bundesrepublik seit den 1980er-Jahren zwar viele neue Freiheiten eröffnete, aber auch eine zunehmende Fragmentierung und einen erstarkenden Nationalismus begünstigte. Aus dieser Gemengelage – ostdeutsche Skepsis und westdeutsche Selbstgewissheit – entstand ein Spannungsfeld, das bis heute in politischen Auseinandersetzungen spürbar ist.
Besonders wertvoll ist Morinas Analyse dort, wo sie historische Entwicklungen mit aktuellen Phänomenen verbindet. Sie zeigt, dass der Aufstieg des Rechtspopulismus nicht aus dem Nichts kam, sondern auf unbearbeiteten Brüchen beruht. Ostdeutsche Erfahrungen mit Machtlosigkeit, Ignoranz gegenüber Bürgeranliegen und mangelnde politische Repräsentation haben dazu beigetragen, dass sich bis heute ein Gefühl der Distanz zum politischen System hält. Gleichzeitig unterschätzte der Westen die Bedeutung dieser „anderen Demokratiegeschichte“ und tat sich schwer, die Erfahrungen der Ostdeutschen als legitimen Teil der gesamtdeutschen Geschichte anzuerkennen. Damit liefert das Buch nicht nur eine historische Analyse, sondern auch einen Erklärungsansatz für die prekären Lagen der Gegenwart. Die Skepsis gegenüber Institutionen, die Suche nach Alternativen jenseits der etablierten Parteien und die Faszination für populistische Bewegungen lassen sich besser verstehen, wenn man die langen Linien dieser Demokratiegeschichten kennt.
Obwohl es sich um ein fundiertes, quellengesättigtes Sachbuch handelt, ist „Tausend Aufbrüche“ gut lesbar. Morina schreibt klar, strukturiert und ohne Fachjargon. Ihre Stärke liegt darin, komplexe Entwicklungen in nachvollziehbare Geschichten zu übersetzen. Die Quellen, die sie heranzieht, sind oft erstaunlich lebendig: Briefe voller Wut, Hoffnungen, Forderungen, aber auch Resignation. Dadurch entsteht ein Bild, das sowohl analytisch präzise als auch menschlich berührend ist.
Das Urteil der Jury des Deutschen Sachbuchpreises bringt es auf den Punkt: Morina „riskiert viel, ohne zu polarisieren“. Sie nimmt die Leser mit in ein Spannungsfeld, das oft von Schwarz-Weiß-Malerei geprägt ist, und zeigt stattdessen die Grauzonen: die Vielfalt von Haltungen, die Ambivalenzen, die kleinen Aufbrüche, die nicht immer große Veränderungen nach sich zogen, aber doch Spuren hinterließen.
„Tausend Aufbrüche“ ist mehr als ein Geschichtsbuch. Es ist ein Plädoyer dafür, Demokratie als Prozess zu verstehen – nie abgeschlossen, immer umkämpft, voller Rückschläge und Neubeginne. Gerade darin liegt seine Aktualität: In einer Zeit, in der Demokratie vielfach als selbstverständlich betrachtet oder im Gegenteil als gescheitert abgetan wird, erinnert Morina daran, dass Demokratie vor allem eines ist: Arbeit.
Die Lektüre kann unbequem sein, weil sie liebgewonnene Narrative in Frage stellt – etwa die Vorstellung, dass der Westen nach 1990 einfach das funktionierende Modell geliefert hat und der Osten sich anpassen musste. Stattdessen zeigt Morina, dass beide Teile Deutschlands ihre eigenen Demokratietraditionen und -brüche mitgebracht haben und dass ein gemeinsames Verständnis nur im Dialog entstehen kann. Wer verstehen will, warum die politische Landschaft heute so zerrissen wirkt, findet hier Antworten – nicht in simplen Thesen, sondern in einem differenzierten Bild von Erfahrungen, Hoffnungen und Enttäuschungen.
16.09.2025 12:33 Uhr
• Sebastian Schmitt
Kurz-URL: qmde.de/164239
