
Der Fernsehfriedhof: Wie eine BILD-Zeitung mit Niveau
Christian Richter erinnert an all die Fernsehformate, die längst im Schleier der Vergessenheit untergegangen sind. Folge 309: «0137» - Eine Talkshow, die einen Kannibalen, einen Bankräuber, einen Pornostar und ein paar Terroristen zu Wort kommen ließ und dafür sogar mehrfach ausgezeichnet wurde.
Liebe Fernsehgemeinde, heute gedenken wir eines Mannes, den der SPIEGEL als „einen Intellektuellen im Nullmedium Fernsehen“ bezeichnete.
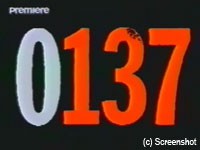 «0137» wurde im Frühjahr 1991 geboren und war ein gezieltes Mittel, um den neuen Pay-TV-Anbieter Premiere bekannt zu machen. Dieser hatte nämlich am 28. Februar seinen Sendebetrieb aufgenommen und strahlte neben einem hauptsächlich codierten Programm einzelne Formate auch unverschlüsselt aus, wodurch diese selbst für Nicht-Premiere-Kunden zugänglich waren. Aus der daraus erzielten Werbewirkung hoffte man, möglichst viele neue Abonnenten für das kostenpflichtige Angebot anlocken zu können. Dafür sollte der Kanal einige revolutionäre Ansätze entwickeln, aus denen Klassiker wie «Studio/Mohr», «Kalkofes Mattscheibe» und «Zapping» hervorgingen.
«0137» wurde im Frühjahr 1991 geboren und war ein gezieltes Mittel, um den neuen Pay-TV-Anbieter Premiere bekannt zu machen. Dieser hatte nämlich am 28. Februar seinen Sendebetrieb aufgenommen und strahlte neben einem hauptsächlich codierten Programm einzelne Formate auch unverschlüsselt aus, wodurch diese selbst für Nicht-Premiere-Kunden zugänglich waren. Aus der daraus erzielten Werbewirkung hoffte man, möglichst viele neue Abonnenten für das kostenpflichtige Angebot anlocken zu können. Dafür sollte der Kanal einige revolutionäre Ansätze entwickeln, aus denen Klassiker wie «Studio/Mohr», «Kalkofes Mattscheibe» und «Zapping» hervorgingen.
Als erstes Projekt setzte das Unternehmen jedoch eine 45minütige Talkshow um, die werktäglich zwischen 19.30 und 20.15 Uhr für große Aufmerksamkeit sorgte. Und das, obwohl darin nicht vornehmlich Prominente auftraten, die ihre aktuellen Projekte bewarben, oder lautstarke Konfrontationen provoziert wurden - wie damals in «Explosiv – Der heiße Stuhl» und «A.T. - Die andere Talkshow» üblich. Stattdessen strebte das Konzept das Entstehen von seriösen und gehaltvollen Gesprächen an. In der Regel gab es dazu pro Ausgabe drei Gäste zu drei verschiedenen Themen, wobei sich deren Auswahl und Reihenfolge am Aufbau einer überregionalen Tageszeitung orientierte. Gewöhnlich wurde mit einem Interview zu einem aktuellen Ereignis begonnen (vergleichbar der „Seite 1“), dann folgte ein Schwerpunkt-Thema („Seite 3“), bevor eine Persönlichkeit aus dem Bereich „Buntes und Vermischtes“ den Abschluss bildete. Weil der Pay-TV-Sender auch in seinem unverschlüsselten Fenster keine Werbung zeigte, konnte sich die Redaktion von jeglichem Quotendruck befreien und Menschen einladen, die weder prominent noch besonders telegen waren. Man hatte den Luxus, sich ganz auf interessante Geschichten konzentrieren zu können. Als zusätzliche Attraktion existierte ein Element der Zuschauerbeteiligung, denn in der Regel konnte das Publikum per Telefon aus einer Auswahl über den dritten Gast der nächsten Episode abstimmen. Die Vorwahl der zugehörigen Rufnummer lieferte zugleich den Titel für die gesamte Sendung. Mitunter diente die Nummer für zusätzliche Blitz-Umfragen, deren Ergebnisse direkt in die laufende Folge einflossen.
 Ein winziges, in schmucklosem grau gehaltenes Studio, in dem lediglich ein genauso schmuckloser Tisch stand, bot den Rahmen für das ambitionierte Vorhaben. Auf Zuspielfilme, Straßenumfragen, Animationen oder ein Studiopublikum wurde vollends verzichtet. Zuweilen waren die Gäste nicht einmal im Studio zugegen, sondern nur über einen Bildschirm zugeschaltet. Geschuldet war dies dem geringen Produktionsbudget, das nicht einmal die Verwendung von kostenpflichtigem Bildmaterial zuließ. Diese puristische Aufbereitung erwies sich bald als die eigentliche Stärke des Formats, denn so lag die Aufmerksamkeit ausschließlich auf den eindrucksvollen Gesprächen, was vielen Kritikern gefiel.
Ein winziges, in schmucklosem grau gehaltenes Studio, in dem lediglich ein genauso schmuckloser Tisch stand, bot den Rahmen für das ambitionierte Vorhaben. Auf Zuspielfilme, Straßenumfragen, Animationen oder ein Studiopublikum wurde vollends verzichtet. Zuweilen waren die Gäste nicht einmal im Studio zugegen, sondern nur über einen Bildschirm zugeschaltet. Geschuldet war dies dem geringen Produktionsbudget, das nicht einmal die Verwendung von kostenpflichtigem Bildmaterial zuließ. Diese puristische Aufbereitung erwies sich bald als die eigentliche Stärke des Formats, denn so lag die Aufmerksamkeit ausschließlich auf den eindrucksvollen Gesprächen, was vielen Kritikern gefiel.
 Für deren hervorragende Qualität war hauptsächlich der Moderator Roger Willemsen verantwortlich, was deswegen erstaunlich war, weil es sich hierbei um seine erste Arbeit vor einer Kamera handelte. Zuvor war der 35jährige Autor und Literaturwissenschaftler bei einem Casting aufgefallen und geradewegs engagiert worden. Insbesondere in dieser Unerfahrenheit mit dem Medium Fernsehen sah der SPIEGEL im Juni 1991 dessen besonderen Vorteil: „Willemsen hat vor dem Medium keinen Respekt. Er bemüht sich nicht, besonders witzig oder brillant zu wirken. Lieber verläßt er sich auf seine profunde humanistische Bildung und die Fähigkeit zum Zuhören.“ Ähnlich euphorisch fiel das Urteil des Journalisten Reinhard Lüke aus, der Willemsens „konzentrierte Zurückhaltung“ hervorhub, die ihn im deutschen Fernsehen „so leicht keiner nach“ mache.
Für deren hervorragende Qualität war hauptsächlich der Moderator Roger Willemsen verantwortlich, was deswegen erstaunlich war, weil es sich hierbei um seine erste Arbeit vor einer Kamera handelte. Zuvor war der 35jährige Autor und Literaturwissenschaftler bei einem Casting aufgefallen und geradewegs engagiert worden. Insbesondere in dieser Unerfahrenheit mit dem Medium Fernsehen sah der SPIEGEL im Juni 1991 dessen besonderen Vorteil: „Willemsen hat vor dem Medium keinen Respekt. Er bemüht sich nicht, besonders witzig oder brillant zu wirken. Lieber verläßt er sich auf seine profunde humanistische Bildung und die Fähigkeit zum Zuhören.“ Ähnlich euphorisch fiel das Urteil des Journalisten Reinhard Lüke aus, der Willemsens „konzentrierte Zurückhaltung“ hervorhub, die ihn im deutschen Fernsehen „so leicht keiner nach“ mache.
Seine „präzis-direkte wie einfühlsame Fragetechnik“ und seine „klug artikulierte und bewegliche Neugier“ brachten Willemsen schließlich den Bayerischen Filmpreis sowie den renommierten Grimme-Preis in Gold ein. Die zugehörige Begründung der Jury schloss nahtlos an die bereits zitierten Lobeshymnen an: „Willemsen fragt freundlich, nachdenklich, listig, klug, witzig, voller kleine Überraschungscoups. Gut informiert. Und, vor allem, immer anders, je nachdem, wer ihm gegenübersitzt: einem medienroutinierten Bonner Polit-Profi kommt er ebenso wie einer Krankenschwester nah - er fühlt sich in die Psyche eines Mörders ein, frotzelt charmant mit einer Schlagersängerin. Wird persönlich ohne die Grenzen der Intimität zu überschreiten.“
Angesichts all dieser Anerkennung, die sich auf die gesamte Sendung und auf den Anbieter Premiere übertrug, ist es umso bemerkenswerter, dass Willemsen ursprünglich gar nicht als Hauptmoderator vorgesehen war. Eigentlich sollte er lediglich die Urlaubsvertretung für Dietmar Schönherr übernehmen, der zu jener Zeit wesentlich bekannter und erfahrener war. Dieser hatte nämlich als Major Cliff Allister McLane die Hauptrolle in der legendären Serie «Raumpatrouille Orion» übernommen und später durch das umstrittene Unterhaltungsprogramm «Wünsch Dir was» sowie mit «Je später der Abend» durch die erste deutsche Talkshow geführt. Doch weil Schönherr kurz vor Produktionsbeginn angeblich vor einem Umzug nach Hamburg zurückschreckte, übernahm Willemsen seine Rolle, was sich nachträglich als glückliche Fügung herausstellte.
 Nun musste wiederum für Willemsen eine Vertretung gefunden werden. Die Wahl fiel auf Sandra Maischberger, die zuerst an «Live aus dem Alabama» mitwirkte und danach an der Seite von Erich Böhme Politiker in «Talk im Turm» befragte. Sie stand für den Vorabend von Premiere ab 1992 als zweite Gastgeberin zur Verfügung und überzeugte mit ihrer Diskussionsleitung ähnlich wie ihr Kollege. Gemeinsam mit ihrer Redaktion, die inhaltlich auf die Zuarbeit des Verlags Gruner+Jahr zurückgreifen konnte, gelang es ihnen stets, die enorme Bandbreite an Themen sowie die heikle Gratwanderung zwischen Sensationslust und ernsthaftem Journalismus zu meistern. Zugleich verhinderten sie, dass boulevardeske, intime oder kontroverse Themen allzu reißerisch aufbereitet oder in die Schmuddelecke gerieten.
Nun musste wiederum für Willemsen eine Vertretung gefunden werden. Die Wahl fiel auf Sandra Maischberger, die zuerst an «Live aus dem Alabama» mitwirkte und danach an der Seite von Erich Böhme Politiker in «Talk im Turm» befragte. Sie stand für den Vorabend von Premiere ab 1992 als zweite Gastgeberin zur Verfügung und überzeugte mit ihrer Diskussionsleitung ähnlich wie ihr Kollege. Gemeinsam mit ihrer Redaktion, die inhaltlich auf die Zuarbeit des Verlags Gruner+Jahr zurückgreifen konnte, gelang es ihnen stets, die enorme Bandbreite an Themen sowie die heikle Gratwanderung zwischen Sensationslust und ernsthaftem Journalismus zu meistern. Zugleich verhinderten sie, dass boulevardeske, intime oder kontroverse Themen allzu reißerisch aufbereitet oder in die Schmuddelecke gerieten.
 Auf der eindrucksvollen Liste der Beteiligten fanden sich Politiker wie der PLO-Vorsitzende Yassir Arafat und der Postminister Christian Schwarz-Schilling genauso wie die Pornodarstellerin Sibylle Rauch, der Geiger Yehudi Menuhin oder die Hollywood-Stars Katharine Hepburn und Warren Beatty. Mal lud man ein an Leukämie erkranktes Kind ein, mal einen erfahrenen Autoknacker, mal Angehörige von Mauerschützenopfern und mal einen Sexualexperten. Darüber hinaus erzählte eine ehemalige Geliebte von Fidel Castro davon, wie sie diesen im Auftrag der CIA ermorden sollte. Derweil berichtete ein verurteilter Häftling von seinem Leben in einer amerikanischen Todeszelle. Reinhard Häfner, damals Trainer bei Dynamo Dresden, äußerte sich zur Gewalt von Fußballfans, ein anderer Mann gestand öffentlich von seiner eigenen Mutter vergewaltigt worden zu sein und ein Professor nahm vor der Kamera zu dem Vorwurf Stellung, dem Bundeskanzler ein Ei an den Kopf geworfen zu haben. Es kam aber auch der Japaner Issei Sagawa zu Wort, der eine junge Frau erschossen und anschließend teilweise verspeist hatte. Mitunter gelangen der Redaktion spektakuläre Coups, etwa wenn man live ins All zum Kosmonauten Sergej Krikalew oder am Tag der Rassenunruhen in Los Angeles zum Bürgerrechtler Jesse Jackson schalten konnte. In einer Sonderausgabe durfte Willemsen zudem mit drei inhaftierten RAF-Terroristen in der JVA Celle sprechen. Am denkwürdigsten sollte allerdings der Auftritt des frisch aus dem Gefängnis ausgebrochenen Bankräubers Roland Wedlich geraten, der die Talk-Bühne nutzen wollte, um über die unzureichenden Haftbedingungen zu sprechen. Dies bewirkte, dass die Polizei während der Live-Ausstrahlung das Studio umstellte und ihn umgehend verhaftete.
Auf der eindrucksvollen Liste der Beteiligten fanden sich Politiker wie der PLO-Vorsitzende Yassir Arafat und der Postminister Christian Schwarz-Schilling genauso wie die Pornodarstellerin Sibylle Rauch, der Geiger Yehudi Menuhin oder die Hollywood-Stars Katharine Hepburn und Warren Beatty. Mal lud man ein an Leukämie erkranktes Kind ein, mal einen erfahrenen Autoknacker, mal Angehörige von Mauerschützenopfern und mal einen Sexualexperten. Darüber hinaus erzählte eine ehemalige Geliebte von Fidel Castro davon, wie sie diesen im Auftrag der CIA ermorden sollte. Derweil berichtete ein verurteilter Häftling von seinem Leben in einer amerikanischen Todeszelle. Reinhard Häfner, damals Trainer bei Dynamo Dresden, äußerte sich zur Gewalt von Fußballfans, ein anderer Mann gestand öffentlich von seiner eigenen Mutter vergewaltigt worden zu sein und ein Professor nahm vor der Kamera zu dem Vorwurf Stellung, dem Bundeskanzler ein Ei an den Kopf geworfen zu haben. Es kam aber auch der Japaner Issei Sagawa zu Wort, der eine junge Frau erschossen und anschließend teilweise verspeist hatte. Mitunter gelangen der Redaktion spektakuläre Coups, etwa wenn man live ins All zum Kosmonauten Sergej Krikalew oder am Tag der Rassenunruhen in Los Angeles zum Bürgerrechtler Jesse Jackson schalten konnte. In einer Sonderausgabe durfte Willemsen zudem mit drei inhaftierten RAF-Terroristen in der JVA Celle sprechen. Am denkwürdigsten sollte allerdings der Auftritt des frisch aus dem Gefängnis ausgebrochenen Bankräubers Roland Wedlich geraten, der die Talk-Bühne nutzen wollte, um über die unzureichenden Haftbedingungen zu sprechen. Dies bewirkte, dass die Polizei während der Live-Ausstrahlung das Studio umstellte und ihn umgehend verhaftete.
 Nach rund zwei Jahren, 600 Einsätzen und über 1.000 Gesprächen verließen Willemsen und Maischberger das Team, um sich eigenen Projekten beim ZDF und bei VOX zu widmen. Ihre Nachfolge traten am 15. Februar 1993 die Journalisten Margret Deckenbrock und Hubert Winkels an. Sie setzten die Sendung für etwa ein Jahr in unveränderter Tradition fort, bis die Verantwortlichen von Premiere mit rund 800.000 Abonnenten genug zahlende Kunden versammelt hatten, um die zwar angesehene, aber unrentable Werbeaktion einstellen zu können.
Nach rund zwei Jahren, 600 Einsätzen und über 1.000 Gesprächen verließen Willemsen und Maischberger das Team, um sich eigenen Projekten beim ZDF und bei VOX zu widmen. Ihre Nachfolge traten am 15. Februar 1993 die Journalisten Margret Deckenbrock und Hubert Winkels an. Sie setzten die Sendung für etwa ein Jahr in unveränderter Tradition fort, bis die Verantwortlichen von Premiere mit rund 800.000 Abonnenten genug zahlende Kunden versammelt hatten, um die zwar angesehene, aber unrentable Werbeaktion einstellen zu können.
«0137» wurde am 28. Februar 1994 und damit auf den Tag exakt drei Jahre nach dem Start der Pay-TV-Plattform beerdigt. Die Show hinterließ den Moderator Roger Willemsen, der ab Oktober 1994 mit «Willemsens Woche» eine neue Reihe übernahm, in der er wieder prominente und nichtprominente Menschen interviewte. Seit dessen Ende im Sommer 1998 ist er nur noch sporadisch im Fernsehen zu sehen – oft in herrlich selbstironischen Auftritten. Parallel dazu publiziert er regelmäßig Romane und Sachbücher, wie etwa sein jüngstes Werk „Das Hohe Haus“, in dem er detailliert die Arbeitsweise und Effizienz des Deutschen Bundestags beleuchtet. Sandra Maischberger präsentierte zunächst auf VOX das Format «Spiegel TV Interview», bevor sie mit ihrem täglichen Polit-Talk «Maischberger» bei n-tv weiter positiv auffiel. Im Jahr 2003 übernahm sie schließlich mit Ihrer Sendung «Menschen bei Maischberger» den Platz von Alfred Biolek im Ersten. Übrigens, im Mai 1993 erhielt «0137» im Spätprogramm von Premiere den wöchentlichen Ableger «0137 Night Talk», der eine gänzlich andere Idee verfolgte und die Beteiligungsmöglichkeiten stärker in den Mittelpunkt rückte. Was genau sich dahinter verbarg, kann im kommenden Fernsehfriedhof nachgelesen werden.
Möge die Show in Frieden ruhen!
Die nächste Ausgabe des Fernsehfriedhofs erscheint am Donnerstag, den 27. August 2015.
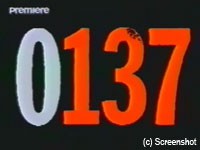 «0137» wurde im Frühjahr 1991 geboren und war ein gezieltes Mittel, um den neuen Pay-TV-Anbieter Premiere bekannt zu machen. Dieser hatte nämlich am 28. Februar seinen Sendebetrieb aufgenommen und strahlte neben einem hauptsächlich codierten Programm einzelne Formate auch unverschlüsselt aus, wodurch diese selbst für Nicht-Premiere-Kunden zugänglich waren. Aus der daraus erzielten Werbewirkung hoffte man, möglichst viele neue Abonnenten für das kostenpflichtige Angebot anlocken zu können. Dafür sollte der Kanal einige revolutionäre Ansätze entwickeln, aus denen Klassiker wie «Studio/Mohr», «Kalkofes Mattscheibe» und «Zapping» hervorgingen.
«0137» wurde im Frühjahr 1991 geboren und war ein gezieltes Mittel, um den neuen Pay-TV-Anbieter Premiere bekannt zu machen. Dieser hatte nämlich am 28. Februar seinen Sendebetrieb aufgenommen und strahlte neben einem hauptsächlich codierten Programm einzelne Formate auch unverschlüsselt aus, wodurch diese selbst für Nicht-Premiere-Kunden zugänglich waren. Aus der daraus erzielten Werbewirkung hoffte man, möglichst viele neue Abonnenten für das kostenpflichtige Angebot anlocken zu können. Dafür sollte der Kanal einige revolutionäre Ansätze entwickeln, aus denen Klassiker wie «Studio/Mohr», «Kalkofes Mattscheibe» und «Zapping» hervorgingen.Als erstes Projekt setzte das Unternehmen jedoch eine 45minütige Talkshow um, die werktäglich zwischen 19.30 und 20.15 Uhr für große Aufmerksamkeit sorgte. Und das, obwohl darin nicht vornehmlich Prominente auftraten, die ihre aktuellen Projekte bewarben, oder lautstarke Konfrontationen provoziert wurden - wie damals in «Explosiv – Der heiße Stuhl» und «A.T. - Die andere Talkshow» üblich. Stattdessen strebte das Konzept das Entstehen von seriösen und gehaltvollen Gesprächen an. In der Regel gab es dazu pro Ausgabe drei Gäste zu drei verschiedenen Themen, wobei sich deren Auswahl und Reihenfolge am Aufbau einer überregionalen Tageszeitung orientierte. Gewöhnlich wurde mit einem Interview zu einem aktuellen Ereignis begonnen (vergleichbar der „Seite 1“), dann folgte ein Schwerpunkt-Thema („Seite 3“), bevor eine Persönlichkeit aus dem Bereich „Buntes und Vermischtes“ den Abschluss bildete. Weil der Pay-TV-Sender auch in seinem unverschlüsselten Fenster keine Werbung zeigte, konnte sich die Redaktion von jeglichem Quotendruck befreien und Menschen einladen, die weder prominent noch besonders telegen waren. Man hatte den Luxus, sich ganz auf interessante Geschichten konzentrieren zu können. Als zusätzliche Attraktion existierte ein Element der Zuschauerbeteiligung, denn in der Regel konnte das Publikum per Telefon aus einer Auswahl über den dritten Gast der nächsten Episode abstimmen. Die Vorwahl der zugehörigen Rufnummer lieferte zugleich den Titel für die gesamte Sendung. Mitunter diente die Nummer für zusätzliche Blitz-Umfragen, deren Ergebnisse direkt in die laufende Folge einflossen.
 Ein winziges, in schmucklosem grau gehaltenes Studio, in dem lediglich ein genauso schmuckloser Tisch stand, bot den Rahmen für das ambitionierte Vorhaben. Auf Zuspielfilme, Straßenumfragen, Animationen oder ein Studiopublikum wurde vollends verzichtet. Zuweilen waren die Gäste nicht einmal im Studio zugegen, sondern nur über einen Bildschirm zugeschaltet. Geschuldet war dies dem geringen Produktionsbudget, das nicht einmal die Verwendung von kostenpflichtigem Bildmaterial zuließ. Diese puristische Aufbereitung erwies sich bald als die eigentliche Stärke des Formats, denn so lag die Aufmerksamkeit ausschließlich auf den eindrucksvollen Gesprächen, was vielen Kritikern gefiel.
Ein winziges, in schmucklosem grau gehaltenes Studio, in dem lediglich ein genauso schmuckloser Tisch stand, bot den Rahmen für das ambitionierte Vorhaben. Auf Zuspielfilme, Straßenumfragen, Animationen oder ein Studiopublikum wurde vollends verzichtet. Zuweilen waren die Gäste nicht einmal im Studio zugegen, sondern nur über einen Bildschirm zugeschaltet. Geschuldet war dies dem geringen Produktionsbudget, das nicht einmal die Verwendung von kostenpflichtigem Bildmaterial zuließ. Diese puristische Aufbereitung erwies sich bald als die eigentliche Stärke des Formats, denn so lag die Aufmerksamkeit ausschließlich auf den eindrucksvollen Gesprächen, was vielen Kritikern gefiel. Für deren hervorragende Qualität war hauptsächlich der Moderator Roger Willemsen verantwortlich, was deswegen erstaunlich war, weil es sich hierbei um seine erste Arbeit vor einer Kamera handelte. Zuvor war der 35jährige Autor und Literaturwissenschaftler bei einem Casting aufgefallen und geradewegs engagiert worden. Insbesondere in dieser Unerfahrenheit mit dem Medium Fernsehen sah der SPIEGEL im Juni 1991 dessen besonderen Vorteil: „Willemsen hat vor dem Medium keinen Respekt. Er bemüht sich nicht, besonders witzig oder brillant zu wirken. Lieber verläßt er sich auf seine profunde humanistische Bildung und die Fähigkeit zum Zuhören.“ Ähnlich euphorisch fiel das Urteil des Journalisten Reinhard Lüke aus, der Willemsens „konzentrierte Zurückhaltung“ hervorhub, die ihn im deutschen Fernsehen „so leicht keiner nach“ mache.
Für deren hervorragende Qualität war hauptsächlich der Moderator Roger Willemsen verantwortlich, was deswegen erstaunlich war, weil es sich hierbei um seine erste Arbeit vor einer Kamera handelte. Zuvor war der 35jährige Autor und Literaturwissenschaftler bei einem Casting aufgefallen und geradewegs engagiert worden. Insbesondere in dieser Unerfahrenheit mit dem Medium Fernsehen sah der SPIEGEL im Juni 1991 dessen besonderen Vorteil: „Willemsen hat vor dem Medium keinen Respekt. Er bemüht sich nicht, besonders witzig oder brillant zu wirken. Lieber verläßt er sich auf seine profunde humanistische Bildung und die Fähigkeit zum Zuhören.“ Ähnlich euphorisch fiel das Urteil des Journalisten Reinhard Lüke aus, der Willemsens „konzentrierte Zurückhaltung“ hervorhub, die ihn im deutschen Fernsehen „so leicht keiner nach“ mache.Seine „präzis-direkte wie einfühlsame Fragetechnik“ und seine „klug artikulierte und bewegliche Neugier“ brachten Willemsen schließlich den Bayerischen Filmpreis sowie den renommierten Grimme-Preis in Gold ein. Die zugehörige Begründung der Jury schloss nahtlos an die bereits zitierten Lobeshymnen an: „Willemsen fragt freundlich, nachdenklich, listig, klug, witzig, voller kleine Überraschungscoups. Gut informiert. Und, vor allem, immer anders, je nachdem, wer ihm gegenübersitzt: einem medienroutinierten Bonner Polit-Profi kommt er ebenso wie einer Krankenschwester nah - er fühlt sich in die Psyche eines Mörders ein, frotzelt charmant mit einer Schlagersängerin. Wird persönlich ohne die Grenzen der Intimität zu überschreiten.“
Angesichts all dieser Anerkennung, die sich auf die gesamte Sendung und auf den Anbieter Premiere übertrug, ist es umso bemerkenswerter, dass Willemsen ursprünglich gar nicht als Hauptmoderator vorgesehen war. Eigentlich sollte er lediglich die Urlaubsvertretung für Dietmar Schönherr übernehmen, der zu jener Zeit wesentlich bekannter und erfahrener war. Dieser hatte nämlich als Major Cliff Allister McLane die Hauptrolle in der legendären Serie «Raumpatrouille Orion» übernommen und später durch das umstrittene Unterhaltungsprogramm «Wünsch Dir was» sowie mit «Je später der Abend» durch die erste deutsche Talkshow geführt. Doch weil Schönherr kurz vor Produktionsbeginn angeblich vor einem Umzug nach Hamburg zurückschreckte, übernahm Willemsen seine Rolle, was sich nachträglich als glückliche Fügung herausstellte.
 Nun musste wiederum für Willemsen eine Vertretung gefunden werden. Die Wahl fiel auf Sandra Maischberger, die zuerst an «Live aus dem Alabama» mitwirkte und danach an der Seite von Erich Böhme Politiker in «Talk im Turm» befragte. Sie stand für den Vorabend von Premiere ab 1992 als zweite Gastgeberin zur Verfügung und überzeugte mit ihrer Diskussionsleitung ähnlich wie ihr Kollege. Gemeinsam mit ihrer Redaktion, die inhaltlich auf die Zuarbeit des Verlags Gruner+Jahr zurückgreifen konnte, gelang es ihnen stets, die enorme Bandbreite an Themen sowie die heikle Gratwanderung zwischen Sensationslust und ernsthaftem Journalismus zu meistern. Zugleich verhinderten sie, dass boulevardeske, intime oder kontroverse Themen allzu reißerisch aufbereitet oder in die Schmuddelecke gerieten.
Nun musste wiederum für Willemsen eine Vertretung gefunden werden. Die Wahl fiel auf Sandra Maischberger, die zuerst an «Live aus dem Alabama» mitwirkte und danach an der Seite von Erich Böhme Politiker in «Talk im Turm» befragte. Sie stand für den Vorabend von Premiere ab 1992 als zweite Gastgeberin zur Verfügung und überzeugte mit ihrer Diskussionsleitung ähnlich wie ihr Kollege. Gemeinsam mit ihrer Redaktion, die inhaltlich auf die Zuarbeit des Verlags Gruner+Jahr zurückgreifen konnte, gelang es ihnen stets, die enorme Bandbreite an Themen sowie die heikle Gratwanderung zwischen Sensationslust und ernsthaftem Journalismus zu meistern. Zugleich verhinderten sie, dass boulevardeske, intime oder kontroverse Themen allzu reißerisch aufbereitet oder in die Schmuddelecke gerieten. Auf der eindrucksvollen Liste der Beteiligten fanden sich Politiker wie der PLO-Vorsitzende Yassir Arafat und der Postminister Christian Schwarz-Schilling genauso wie die Pornodarstellerin Sibylle Rauch, der Geiger Yehudi Menuhin oder die Hollywood-Stars Katharine Hepburn und Warren Beatty. Mal lud man ein an Leukämie erkranktes Kind ein, mal einen erfahrenen Autoknacker, mal Angehörige von Mauerschützenopfern und mal einen Sexualexperten. Darüber hinaus erzählte eine ehemalige Geliebte von Fidel Castro davon, wie sie diesen im Auftrag der CIA ermorden sollte. Derweil berichtete ein verurteilter Häftling von seinem Leben in einer amerikanischen Todeszelle. Reinhard Häfner, damals Trainer bei Dynamo Dresden, äußerte sich zur Gewalt von Fußballfans, ein anderer Mann gestand öffentlich von seiner eigenen Mutter vergewaltigt worden zu sein und ein Professor nahm vor der Kamera zu dem Vorwurf Stellung, dem Bundeskanzler ein Ei an den Kopf geworfen zu haben. Es kam aber auch der Japaner Issei Sagawa zu Wort, der eine junge Frau erschossen und anschließend teilweise verspeist hatte. Mitunter gelangen der Redaktion spektakuläre Coups, etwa wenn man live ins All zum Kosmonauten Sergej Krikalew oder am Tag der Rassenunruhen in Los Angeles zum Bürgerrechtler Jesse Jackson schalten konnte. In einer Sonderausgabe durfte Willemsen zudem mit drei inhaftierten RAF-Terroristen in der JVA Celle sprechen. Am denkwürdigsten sollte allerdings der Auftritt des frisch aus dem Gefängnis ausgebrochenen Bankräubers Roland Wedlich geraten, der die Talk-Bühne nutzen wollte, um über die unzureichenden Haftbedingungen zu sprechen. Dies bewirkte, dass die Polizei während der Live-Ausstrahlung das Studio umstellte und ihn umgehend verhaftete.
Auf der eindrucksvollen Liste der Beteiligten fanden sich Politiker wie der PLO-Vorsitzende Yassir Arafat und der Postminister Christian Schwarz-Schilling genauso wie die Pornodarstellerin Sibylle Rauch, der Geiger Yehudi Menuhin oder die Hollywood-Stars Katharine Hepburn und Warren Beatty. Mal lud man ein an Leukämie erkranktes Kind ein, mal einen erfahrenen Autoknacker, mal Angehörige von Mauerschützenopfern und mal einen Sexualexperten. Darüber hinaus erzählte eine ehemalige Geliebte von Fidel Castro davon, wie sie diesen im Auftrag der CIA ermorden sollte. Derweil berichtete ein verurteilter Häftling von seinem Leben in einer amerikanischen Todeszelle. Reinhard Häfner, damals Trainer bei Dynamo Dresden, äußerte sich zur Gewalt von Fußballfans, ein anderer Mann gestand öffentlich von seiner eigenen Mutter vergewaltigt worden zu sein und ein Professor nahm vor der Kamera zu dem Vorwurf Stellung, dem Bundeskanzler ein Ei an den Kopf geworfen zu haben. Es kam aber auch der Japaner Issei Sagawa zu Wort, der eine junge Frau erschossen und anschließend teilweise verspeist hatte. Mitunter gelangen der Redaktion spektakuläre Coups, etwa wenn man live ins All zum Kosmonauten Sergej Krikalew oder am Tag der Rassenunruhen in Los Angeles zum Bürgerrechtler Jesse Jackson schalten konnte. In einer Sonderausgabe durfte Willemsen zudem mit drei inhaftierten RAF-Terroristen in der JVA Celle sprechen. Am denkwürdigsten sollte allerdings der Auftritt des frisch aus dem Gefängnis ausgebrochenen Bankräubers Roland Wedlich geraten, der die Talk-Bühne nutzen wollte, um über die unzureichenden Haftbedingungen zu sprechen. Dies bewirkte, dass die Polizei während der Live-Ausstrahlung das Studio umstellte und ihn umgehend verhaftete. Nach rund zwei Jahren, 600 Einsätzen und über 1.000 Gesprächen verließen Willemsen und Maischberger das Team, um sich eigenen Projekten beim ZDF und bei VOX zu widmen. Ihre Nachfolge traten am 15. Februar 1993 die Journalisten Margret Deckenbrock und Hubert Winkels an. Sie setzten die Sendung für etwa ein Jahr in unveränderter Tradition fort, bis die Verantwortlichen von Premiere mit rund 800.000 Abonnenten genug zahlende Kunden versammelt hatten, um die zwar angesehene, aber unrentable Werbeaktion einstellen zu können.
Nach rund zwei Jahren, 600 Einsätzen und über 1.000 Gesprächen verließen Willemsen und Maischberger das Team, um sich eigenen Projekten beim ZDF und bei VOX zu widmen. Ihre Nachfolge traten am 15. Februar 1993 die Journalisten Margret Deckenbrock und Hubert Winkels an. Sie setzten die Sendung für etwa ein Jahr in unveränderter Tradition fort, bis die Verantwortlichen von Premiere mit rund 800.000 Abonnenten genug zahlende Kunden versammelt hatten, um die zwar angesehene, aber unrentable Werbeaktion einstellen zu können.«0137» wurde am 28. Februar 1994 und damit auf den Tag exakt drei Jahre nach dem Start der Pay-TV-Plattform beerdigt. Die Show hinterließ den Moderator Roger Willemsen, der ab Oktober 1994 mit «Willemsens Woche» eine neue Reihe übernahm, in der er wieder prominente und nichtprominente Menschen interviewte. Seit dessen Ende im Sommer 1998 ist er nur noch sporadisch im Fernsehen zu sehen – oft in herrlich selbstironischen Auftritten. Parallel dazu publiziert er regelmäßig Romane und Sachbücher, wie etwa sein jüngstes Werk „Das Hohe Haus“, in dem er detailliert die Arbeitsweise und Effizienz des Deutschen Bundestags beleuchtet. Sandra Maischberger präsentierte zunächst auf VOX das Format «Spiegel TV Interview», bevor sie mit ihrem täglichen Polit-Talk «Maischberger» bei n-tv weiter positiv auffiel. Im Jahr 2003 übernahm sie schließlich mit Ihrer Sendung «Menschen bei Maischberger» den Platz von Alfred Biolek im Ersten. Übrigens, im Mai 1993 erhielt «0137» im Spätprogramm von Premiere den wöchentlichen Ableger «0137 Night Talk», der eine gänzlich andere Idee verfolgte und die Beteiligungsmöglichkeiten stärker in den Mittelpunkt rückte. Was genau sich dahinter verbarg, kann im kommenden Fernsehfriedhof nachgelesen werden.
Möge die Show in Frieden ruhen!
Die nächste Ausgabe des Fernsehfriedhofs erscheint am Donnerstag, den 27. August 2015.
30.07.2015 11:05 Uhr
• Christian Richter
Kurz-URL: qmde.de/79813
