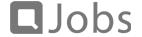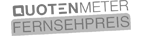Das Mockumentary-Genre ist immer noch eines, welches vom Mainstream-Publikum ungern akzeptiert wird. «The Blair Witch Project» mag die fiktionale Dokumentation einer Geschichte zwar in die Neuzeit geholt haben, und der Trend mag sich mit dem „found footage“-Untergenre in «Cloverfield» und ganz aktuell «Chronicle» im Kino gut vermarkten, doch im Fernsehen hat das Genre Schwierigkeiten überhaupt Anhänger zu finden. «The Office» ist dank seiner Nicht-Präsenz der Kameracrew neben den Charakteren eine Ausnahme, da die Serie es schafft, trotz des dokumentarischen Feelings wie eine „normale“ Comedyserie zu wirken. Und bei «Parks and Recreation» bemerkt man nach einer Weile gar nicht mehr, dass die Serie eigentlich eine Mockumentary sein soll. Es gibt Gründe, warum Mockumentary in Einzelfolgen verschiedener Serien nur als Gimmick eingesetzt wird. Und ABCs Neustart «The River» wiederholt diese Gründe gleich mehrere Male während seiner Premiere. Die übernatürliche Horrorserie kann durch ihr Genre im Fernsehen noch so originell sein, doch das Abenteuer im brasilianischen Amazonas, entwickelt von Oren Peli (Regisseur, Autor und Produzent der «Paranormal Activity»-Filme) und Michael Perry (Ko-Autor für «Paranormal Activity 2»), zeigt, warum ein Gimmick nicht immer hilfreich sein kann, wenn die Charaktere kränkeln.
Das Mockumentary-Genre ist immer noch eines, welches vom Mainstream-Publikum ungern akzeptiert wird. «The Blair Witch Project» mag die fiktionale Dokumentation einer Geschichte zwar in die Neuzeit geholt haben, und der Trend mag sich mit dem „found footage“-Untergenre in «Cloverfield» und ganz aktuell «Chronicle» im Kino gut vermarkten, doch im Fernsehen hat das Genre Schwierigkeiten überhaupt Anhänger zu finden. «The Office» ist dank seiner Nicht-Präsenz der Kameracrew neben den Charakteren eine Ausnahme, da die Serie es schafft, trotz des dokumentarischen Feelings wie eine „normale“ Comedyserie zu wirken. Und bei «Parks and Recreation» bemerkt man nach einer Weile gar nicht mehr, dass die Serie eigentlich eine Mockumentary sein soll. Es gibt Gründe, warum Mockumentary in Einzelfolgen verschiedener Serien nur als Gimmick eingesetzt wird. Und ABCs Neustart «The River» wiederholt diese Gründe gleich mehrere Male während seiner Premiere. Die übernatürliche Horrorserie kann durch ihr Genre im Fernsehen noch so originell sein, doch das Abenteuer im brasilianischen Amazonas, entwickelt von Oren Peli (Regisseur, Autor und Produzent der «Paranormal Activity»-Filme) und Michael Perry (Ko-Autor für «Paranormal Activity 2»), zeigt, warum ein Gimmick nicht immer hilfreich sein kann, wenn die Charaktere kränkeln.Dokumentarfilmer und Entdecker Dr. Emmet Cole (Bruce Greenwood) ist der Star seiner TV-Sendung „The Undiscovered Country“ seit mehr als 20 Jahren. Der langjährige Erfolg der Serie brachte ihn dazu, selbst seine Familie in seine weltweiten Abenteuer zu involvieren: Seine Frau Tess (Leslie Hope) und sein Sohn Lincoln (Joe Anderson) waren vor und hinter der Kamera dabei, wenn Emmet wieder einmal eine unbekannte Spezies gefunden hat. Emmets Beruf war es auch, welcher seinen Sohn von ihm entfremdete. Doch Emmet wurde vor sechs Monaten als vermisst erklärt, als er im Amazonasgebiet spurlos verschwunden ist. Ein Begräbnis wurde für ihn abgehalten, und Lincoln hat sich mit dem unrühmlichen Ende seines Vaters abgefunden. Bis Tess auf ihn zukommt, und ihn überredet, im Amazonas nach Emmet zu suchen. Emmets persönliches SOS-Signal leuchtet mitten im Nirgendwo auf, und es besteht die Chance, dass er noch am Leben ist. Eine Kameracrew, die in der Suche nach Emmet eine neue Dokumentarserie sehen, begleitet Tess und Lincoln in den Amazonas. Zusammen mit dem Produzent Carl (Paul Blackthorne), Bootsmechaniker Emilio (Daniel Zacapa), Bodyguard Kurt (Thomas Kretschmann) und weiteren Personen begeben sich Emmets Ehefrau und Sohn auf die Suche nach einem Lebenszeichen des Forschers. Und das nicht ohne die Magie des Amazonas zu entdecken – die bisweilen tödlich sein kann.
 «The River» ist von der ersten bis zur letzten Sekunde aufgezogen, als gehöre es unter die Bezeichnung des „found footage“-Genres. Dabei hätte sich die Möglichkeit ergeben, den Dokumentaraspekt spärlicher, und damit realistischer, einzusetzen. Denn nach einer Stunde kann der geneigte Zuschauer von den schnellen Schnitten und den Unmengen an Kameras durchaus genervt sein. Überhaupt scheint es wie ein Wunder zu wirken, dass sich auf einem Boot gefühlte 100 Kameras befinden, die jeden Millimeter und Gesichtsausdruck der Charaktere einfangen sollen. Es gibt keine Privatsphäre, kein Schnitt ist zu schnell, und kein Twist kommt zu spät. Damit hilft man zwar der Story auf die Sprünge, die dem Zuschauer keine Zeit lässt zum Durchatmen, doch die Charaktere leiden darunter. Denn es gibt absolut keine nennenswerten Charakterzeichnungen, welche das Leiden und Leben der beteiligten Personen interessant für den Zuschauer machen. Dass der Dschungel und seine Magie tödlich ist, wird schnell klar. Doch den Zuschauern wird keine Möglichkeit gegeben, überhaupt mit den Charakteren mitzufiebern.
«The River» ist von der ersten bis zur letzten Sekunde aufgezogen, als gehöre es unter die Bezeichnung des „found footage“-Genres. Dabei hätte sich die Möglichkeit ergeben, den Dokumentaraspekt spärlicher, und damit realistischer, einzusetzen. Denn nach einer Stunde kann der geneigte Zuschauer von den schnellen Schnitten und den Unmengen an Kameras durchaus genervt sein. Überhaupt scheint es wie ein Wunder zu wirken, dass sich auf einem Boot gefühlte 100 Kameras befinden, die jeden Millimeter und Gesichtsausdruck der Charaktere einfangen sollen. Es gibt keine Privatsphäre, kein Schnitt ist zu schnell, und kein Twist kommt zu spät. Damit hilft man zwar der Story auf die Sprünge, die dem Zuschauer keine Zeit lässt zum Durchatmen, doch die Charaktere leiden darunter. Denn es gibt absolut keine nennenswerten Charakterzeichnungen, welche das Leiden und Leben der beteiligten Personen interessant für den Zuschauer machen. Dass der Dschungel und seine Magie tödlich ist, wird schnell klar. Doch den Zuschauern wird keine Möglichkeit gegeben, überhaupt mit den Charakteren mitzufiebern.Die Schuld ist hier dem übereifrigen Einsatz der verschiedenen Dokumentarkameras zu geben. Statt mit einer Kamera, ohne Schnitt, zwischen zwei Charakteren hin- und herzuwechseln, machen die Produzenten von [The River]] es sich viel zu einfach. Und Oren Peli müsste das genau wissen. Er könnte zwar als Fachmann des Genres beschrieben werden, nachdem es ihm in «Paranormal Activity» gelang die Angst und Panik der Charaktere auf die Zuschauer zu übertragen, doch dort hatte er mehr als eine Stunde Zeit dafür - und musste nicht mit einer handvoll Protagonisten in Lebensgefahr hantieren. In «The River» hat Peli weniger als 45 Minuten, nicht nur die Prämisse an die Zuschauer zu verkaufen, sondern auch eine Mythologie zu entwickeln, seine Charaktere vorzustellen, und diese glaubhaft in den Amazonas zu verfrachten. Und für all das ist einfach keine Zeit, um die Premiere dann noch mit einem generischen Plot zu garnieren, der genauso gut aus «Supernatural» hätte stammen können. Dass die Geschichte auch nicht originell ist, zeigen die vielen (ungewollten?) Genre-Hommagen vergangener Serien – «Lost» scheint dabei nur die Spitze des Eisberges zu sein. Mit dem Amazonas-Setting sind die Autoren in der Lage, sich bei Peter Benchleys Serie «Amazonas – Gefangene des Dschungels» zu bedienen; die Geistergeschichte, deren Aufbau und die Suche nach Emmet erinnert vor allem gegen Ende viel zu sehr an das schon angesprochene «Supernatural» und die Suche nach John Winchester; das chaotische Durcheinander unter den Charakteren auf dem Schiff spiegelt das Chaos unter den zukünftigen Hakenmann-Opfern von «Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast» wieder (es gibt einfach keinen Moment der Ruhe, wenn die Kacke erst am Dampfen ist); und der Einsatz der Kameras in das Leben der Charaktere ist auch schon aus NBCs gefloppten Sommerevent-Versuch «Persons Unknown» bekannt.
 Das einzige, was also wirklich neu an «The River» ist, ist der dokumentarische Ansatz. Dieser funktionierte allerdings schon nicht, als ABC es in der Vergangenheit mit zwei Mockumentary-Serien versuchte. Im Herbst 2010 scheiterte schon die Dramaserie «My Generation» (eine Kameracrew begleitet die Studenten einer 2000-Abschlussklasse zehn Jahre nach ihrem Abschluss) nach zwei Episoden. Und während der Produktion von «Detroit 187» wurde der dokumentarische Ansatz sogar völlig gestrichen, und aus der Serie wurde eines der üblichen dreckigen und rauen Copdramen. Dass ABC immer noch genügend Vertrauen ins Genre hatte, um «The River» zur Serie zu bestellen, scheint wie ein unbegreifliches Wunder. Hier muss man sich allerdings fragen, ob die Beteiligung von Oren Peli nicht der entscheidende Grund war, warum die Serie letztendlich bestellt wurde.
Das einzige, was also wirklich neu an «The River» ist, ist der dokumentarische Ansatz. Dieser funktionierte allerdings schon nicht, als ABC es in der Vergangenheit mit zwei Mockumentary-Serien versuchte. Im Herbst 2010 scheiterte schon die Dramaserie «My Generation» (eine Kameracrew begleitet die Studenten einer 2000-Abschlussklasse zehn Jahre nach ihrem Abschluss) nach zwei Episoden. Und während der Produktion von «Detroit 187» wurde der dokumentarische Ansatz sogar völlig gestrichen, und aus der Serie wurde eines der üblichen dreckigen und rauen Copdramen. Dass ABC immer noch genügend Vertrauen ins Genre hatte, um «The River» zur Serie zu bestellen, scheint wie ein unbegreifliches Wunder. Hier muss man sich allerdings fragen, ob die Beteiligung von Oren Peli nicht der entscheidende Grund war, warum die Serie letztendlich bestellt wurde.Während Carls Dokumentation also die Charaktere auf der Suche nach Emmet begleitet, und von einer Kamera zur nächsten wechselt (und das offenbar in Rekordzeit), geht die Charakterisierung flöten. Warum Lincoln die Abenteuer seines Vaters im späteren Leben verabscheute, ist unklar. Warum ein Sender daran interessiert ist, die Suche nach Emmet zu filmen, ist unklar. Warum Kameras selbst in den Schränken der privaten Unterkünfte auf dem Boot Magus angebracht wurden, ist unklar. Warum der titelgebende Fluss nichts anderes ist als der Ort des Geschehens, liegt wohl am Marketing der Serie, welches offensichtlich den falschen Titel wählte. Nicht mal der Amazonas kommt exotisch herüber und kann ein wenig von der Atmosphäre des Unbekannten leben. «The River» besteht nur aus einem Boot, eine handvoll verängstigter Charaktere, und übernatürlichen Elementen in Standardform. Es ist quasi alles schon mal dagewesen – bis auf das Genre.
 Mit weitaus weniger Kameras auf dem Schiff und an den Körpern der Charaktere würde «The River» es auch gelingen, weitaus spannender zu sein. Es hilft dem Aufbau des Terrors nicht, wenn die Szene ständig von Kamera zu Kamera wechselt, und dem Zuschauer nicht einmal Zeit gibt, die Situation zu kaufen und zu akzeptieren. Es hilft nicht, um das Leben der Protagonisten zu bangen, wenn sich nur auf die Geisterstory konzentriert wird. Es hilft der Serie nicht, ein Mysterium aufzubauen, wenn die Handlung keine Möglichkeit sieht, genauer auf Emmets Videotagebuch einzugehen. Da haben die Autoren mit den Flashbacks ein interessantes Element in die Serie mit eingebaut und sie benutzen es nicht. Das ist der Grund, warum es «The River» nicht gelingt, genügend Spannung aufzubauen. Der Pilot schraubt die Spannungsschraube in schnellen Schnitten nach oben, doch der Horrormoment löst sich in Luft auf und verschwindet ins Nirvana. Zusammen mit den uninteressanten Charakteren gelingt es «The River» nicht wirklich unterhaltsam zu sein.
Mit weitaus weniger Kameras auf dem Schiff und an den Körpern der Charaktere würde «The River» es auch gelingen, weitaus spannender zu sein. Es hilft dem Aufbau des Terrors nicht, wenn die Szene ständig von Kamera zu Kamera wechselt, und dem Zuschauer nicht einmal Zeit gibt, die Situation zu kaufen und zu akzeptieren. Es hilft nicht, um das Leben der Protagonisten zu bangen, wenn sich nur auf die Geisterstory konzentriert wird. Es hilft der Serie nicht, ein Mysterium aufzubauen, wenn die Handlung keine Möglichkeit sieht, genauer auf Emmets Videotagebuch einzugehen. Da haben die Autoren mit den Flashbacks ein interessantes Element in die Serie mit eingebaut und sie benutzen es nicht. Das ist der Grund, warum es «The River» nicht gelingt, genügend Spannung aufzubauen. Der Pilot schraubt die Spannungsschraube in schnellen Schnitten nach oben, doch der Horrormoment löst sich in Luft auf und verschwindet ins Nirvana. Zusammen mit den uninteressanten Charakteren gelingt es «The River» nicht wirklich unterhaltsam zu sein.Am Ende ist die Serie nur ein schnell geschnittener B-Horror, welcher interessant klingt und aussieht, doch nichts aus seinen Möglichkeiten macht. «The River» hat allerdings nur acht Episoden, warum es sich durchaus lohnen könnte, Zeit in eine Serie außerhalb des Cop-Procedurals und der Anwaltsdramen zu investieren. Fans des „found footage“-Genres werden sicherlich Gefallen finden, Horrorfans können sich auf Geistergeschichten freuen, und Epileptiker sollten gar nicht erst einschalten. Wenn schon ein Brechreizgefühl am Ende von «The Blair Witch Project» zustande kam (wenn Heather mit ihrer Kamera die Treppen hinunter läuft), wird es «The River» besonders einfach haben, das Gefühl zu regenerieren. Stille Kameras ist auch für diese Serie ein Fremdwort. Bevor Kritiker jedoch dem Begriff „Unoriginalität“ umherschmeißen, sollte erst einmal abgewartet werden, wie lange «The River» braucht, bis der klassische J.Lo-Schinken «Anaconda» entweder mit einer Hommage geehrt oder parodiert wird.






 VOX sieht uns «Unter Beobachtung»
VOX sieht uns «Unter Beobachtung» «Quatsch Comedy Club» feiert ordentlich
«Quatsch Comedy Club» feiert ordentlich










 Assistenz der Geschäftsführung (m/w/d)
Assistenz der Geschäftsführung (m/w/d) Initiativbewerbungen (m/w/d)
Initiativbewerbungen (m/w/d) Redaktionsassistenz (m/w/d)
Redaktionsassistenz (m/w/d)